Tödliche "Terroristenfahndung"
Polizeiliche Todesschüsse, ihre Ursachen und "Bewältigung" unter den Bedingungen des staatlichen "Anti-Terror-Kampfes"
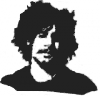


Rolf Gössner 1 *
 Der erste Mensch der in der Auseinandersetzung zwischen bewaffneten Gruppen und dem Staat ums Leben kam, wurde im Zuge einer Groß-Fahndungsaktion von der Polizei erschossen: 3000 Polizeibeamte sperrten am Morgen des 15. Juli 1971 die wichtigsten Straßen in ganz Norddeutschland ab und führten Verkehrskontrollen durch. Tausende von Fahrzeugen wurden kontrolliert. Es handelte sich bei dieser Aktion unter dem Decknamen "Hecht" um die bis dahin größte Fahndung nach Mitgliedern der Baader-Meinhof-Ensslin-Gruppe. Als in Hamburg ein BMW eine der 15 Polizeisperren durchbrochen hatte, wurde das Flucht-Fahrzeug von Polizeiwagen verfolgt und gestellt. Die Fahrerin und der Beifahrer flohen zu Fuß weiter, wobei sie angeblich, so die Polizei, geschossen haben sollen, ohne allerdings jemanden zu verletzen. Über 80 Polizeibeamte wurden aufgeboten. Zunächst konnte der Beifahrer von Polizeikräften umzingelt und festgenommen werden: Es handelte sich um Werner Hoppe. Die fliehende Fahrerin, die nach Polizeiangaben die Pistole gezogen und geschossen haben soll, wurde von einem Polizisten erschossen: Es handelte sich um die zwanzigjährige Petra Schelm, die durch einen Kopfschuß getötet wurde. Zunächst war angenommen worden, es handele sich um Ulrike Meinhof. 2 * Ein Ermittlungsverfahren gegen den Todesschützen wurde schon wenig später eingestellt: Der Polizist habe aus "Notwehr" gehandelt. Der überlebende Werner Hoppe dagegen wurde in einem fragwürdigen Strafverfahren wegen dreifachen Totschlagversuchs zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt3 *, obwohl er nicht einen einzigen Menschen auch nur verletzt hat. Das Urteil stützt sich auf widersprüchliche Aussagen der beteiligten Polizeibeamten, die ihrerseits den Tod Petra Schelms verursacht hatten. Hoppes Verteidiger Heinrich Hannover brachte diese unterschiedliche Behandlung bei Tötungsdelikten in seinem Schlußplädoyer4 * auf den Begriff:
Der erste Mensch der in der Auseinandersetzung zwischen bewaffneten Gruppen und dem Staat ums Leben kam, wurde im Zuge einer Groß-Fahndungsaktion von der Polizei erschossen: 3000 Polizeibeamte sperrten am Morgen des 15. Juli 1971 die wichtigsten Straßen in ganz Norddeutschland ab und führten Verkehrskontrollen durch. Tausende von Fahrzeugen wurden kontrolliert. Es handelte sich bei dieser Aktion unter dem Decknamen "Hecht" um die bis dahin größte Fahndung nach Mitgliedern der Baader-Meinhof-Ensslin-Gruppe. Als in Hamburg ein BMW eine der 15 Polizeisperren durchbrochen hatte, wurde das Flucht-Fahrzeug von Polizeiwagen verfolgt und gestellt. Die Fahrerin und der Beifahrer flohen zu Fuß weiter, wobei sie angeblich, so die Polizei, geschossen haben sollen, ohne allerdings jemanden zu verletzen. Über 80 Polizeibeamte wurden aufgeboten. Zunächst konnte der Beifahrer von Polizeikräften umzingelt und festgenommen werden: Es handelte sich um Werner Hoppe. Die fliehende Fahrerin, die nach Polizeiangaben die Pistole gezogen und geschossen haben soll, wurde von einem Polizisten erschossen: Es handelte sich um die zwanzigjährige Petra Schelm, die durch einen Kopfschuß getötet wurde. Zunächst war angenommen worden, es handele sich um Ulrike Meinhof. 2 * Ein Ermittlungsverfahren gegen den Todesschützen wurde schon wenig später eingestellt: Der Polizist habe aus "Notwehr" gehandelt. Der überlebende Werner Hoppe dagegen wurde in einem fragwürdigen Strafverfahren wegen dreifachen Totschlagversuchs zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt3 *, obwohl er nicht einen einzigen Menschen auch nur verletzt hat. Das Urteil stützt sich auf widersprüchliche Aussagen der beteiligten Polizeibeamten, die ihrerseits den Tod Petra Schelms verursacht hatten. Hoppes Verteidiger Heinrich Hannover brachte diese unterschiedliche Behandlung bei Tötungsdelikten in seinem Schlußplädoyer4 * auf den Begriff:
"Wer einen anderen Menschen im Interesse der herrschenden Klasse tötet, bleibt straffrei; wer tötet, ohne daß dies im Interesse der herrschenden Klasse geschieht, ist kriminell und hart zu bestrafen." Und der ehemalige Bundesinnenminister Fried-rich Zimmermann (CSU) bestätigt 15 Jahre später diese Erkenntnis auf seine Weise: Anläßlich der Erschießung zweier Polizeibeamter während einer Demonstration gegen die Startbahn-West bei Frankfurt im November 1987 erklärt er kurzerhand den "Mord an Polizisten" zum "schlimmsten aller Morde".5 * Diese Wertmaßstäbe ziehen sich durch die gesamte Geschichte der staatlichen "Terrorismusbekämpfung" und ihrer gerichtlichen Nachbereitung. Nach dem lange nachwirkenden Trauma der ebenfalls ungesühnt gebliebenen polizeilichen Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg im Jahre 19676 * hat nun dieser neue polizeiliche Todesschuß, dem Petra Schelm 1971 zum Opfer fiel, ebenfalls stark prägende Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der politischen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik gezeitigt: "Damit war zum erstenmal ein Wildwest-Muster aufgetaucht - von den 'Anarchisten' wurde angenommen oder behauptet, daß sie rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch machten, was entsprechende Präventivschläge von Polizeibeamten begünstigte und zugleich rechtfertigte oder aber die Rechtsfigur der Putativnotwehr zumindest entschuldigte. Dies wiederum mußte die Bereitschaft der Gruppenmitglieder erhöhen, bei Polizeikontakten in der Tat sofort zu schießen", notierte der Kriminologe und Sozialwissenschaftler Sebastian Scheerer.7 *
Im Zusammenhang mit diesem ersten Todesopfer eines polizeilich inszenierten "kurzen Prozesses", als welcher dieses Ereignis auch in der Öffentlichkeit registriert und kritisiert wurde, ist auf den viel zitierten Satz von Ulrike Meinhof einzugehen, dessen Authentizität allerdings bestritten wird:8 * "... und natürlich kann (auf Bullen) geschossen werden" (1970), ein Satz, der immer wieder als Rechtfertigung für polizeiliches Vorgehen, für polizeiliche Todesschüsse herangezogen wurde. Andererseits wird aber aus der authentischen RAF-Schrift "Das Konzept Stadtguerilla"9 *, die bereits ab April 1971 zirkulierte, deutlich, daß RAF-Mitglieder nach ihrem eigenen Selbstverständnis eben "nicht 'rücksichtslos' von der Schußwaffe Gebrauch" machen, daß sie bislang in Festnahmesituationen entweder überhaupt nicht oder aber nicht gezielt geschossen hätten, während die Polizei jedesmal zuerst und gezielte Schüsse abgegeben habe. Diese grundsätzliche Einstellung kann auch aus folgenden Formulierungen derselben RAF-Schrift abgelesen werden, die eher "die restriktive Anwendung revolutionärer Gewalt in Situationen der Notwehr oder Nothilfe" nahelegen (Scheerer):10 * "Stadtguerilla ist bewaffneter Kampf, insofern es die Polizei ist, die rücksichtslos von der Schußwaffe Gebrauch macht..."; "Wir schießen, wenn auf uns geschossen wird. Den Bullen, der uns laufen läßt, lassen wir auch laufen". Zur Verhältnismäßigkeit der polizeilichen Aktionen im Rahmen von "Terrorismus"-Großfahndungen heißt es weiter: "Es ist richtig, wenn behauptet wird, mit dem immensen Fahndungsaufwand gegen uns sei die ganze sozialistische Linke in der Bundesrepublik gemeint. Weder das bißchen Geld, das wir geklaut haben sollen, noch die paar Auto- und Dokumentendiebstähle, derentwegen gegen uns ermittelt wird, auch nicht der Mordversuch, den man uns anzuhängen versucht, rechtfertigen für sich den Tanz. Der Schreck ist den Herrschenden in die Knochen gefahren..."
Grenzgänger des Rechtsstaates in der etablierten Politik haben in den frühen siebziger Jahren diesen "Schreck" zum Anlaß genommen, die sich abzeichnende "Eskalation der Gewalt" u.a. mittels Fahndungsdruck und Propaganda fleißig zu schüren: "Wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will," so ließ etwa der ehemalige SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt verlauten,11 * "der muß auch bereit sein, bis an die Grenze dessen zu gehen, was vom Rechtsstaat erlaubt und geboten ist". Und der ehemalige FDP-Bundesinnenminister Werner Maihofer präzisierte: "Im Kampf gegen den Terrorismus müssen wir bis an die äußerste Grenze unseres freiheitlichen Rechtsstaates gehen. Das sind wir der Sicherheit unserer Bürger schuldig."12 * Oder meinte er nicht eher der "Staatsräson"?
Rund die Hälfte aller Toten im bewaffneten Konflikt zwischen bundesdeutscher Staatsgewalt und Stadtguerilla der siebziger Jahre gab es im Zusammenhang mit polizeilichen Fahndungs- und Festnahmeaktionen. Die tödliche Bilanz der Jahre 1971 bis 1980:13 *
Als erste traf es, wie bereits erwähnt, Petra Schelm, die am 15. Juli 1971 in Hamburg im Zuge der bis dahin größten Fahndung nach Mitgliedern der Baader-Meinhof-Ensslin-Gruppe von einem Polizisten durch Kopfschuß getötet wurde.
Von (mutmaßlichen) Mitgliedern bewaffneter Gruppen wurden im Zeitraum von Oktober 1971 bis Ende 1980 insgesamt 8 Polizeibeamte getötet, 5 davon im Zusammenhang mit Fahndungs- bzw. Festnahmesituationen:14 *
- Drei Monate nach dem ersten polizeilichen Todesschuß auf Petra Schelm ist der 32jährige Polizeimeister Norbert Schmid am 22. Oktober 1971 gegen halb zwei Uhr nachts bei der versuchten Festnahme einer Frau von einer hinzueilenden Person aus nächster Nähe erschossen worden. Als Todesschütze ist das damalige RAF-Mitglied Gerhard Müller wiedererkannt worden. Als späterer "Kronzeuge" der Anklagebehörde gegen die RAF wird er dann allerdings, in Übereinstimmung mit der Staatsanwaltschaft, von diesem Mord freigesprochen und u.a. lediglich wegen Beihilfe zum Mord verurteilt; er wird vorzeitig aus der Haft entlassen:15 * "Daß er nun nicht mehr in seiner Zelle sitzt, ist das Resultat einer beispiellosen Manipulation des Rechts. Wohl vor jedem deutschen Schwurgericht wäre Gerhard Müller unter normalen Umständen die lebenslange Freiheitsstrafe sicher gewesen - aufgrund seiner eigenen Aussagen. Doch es ging nicht mit rechten Dingen zu. Das Lebenslang wurde ihm geschenkt: Es war der Kaufpreis, um seine Zunge zu lösen" - so Der Spiegel im Mai 1979 zu diesem Handel.16 *
- Die Namen weiterer Polizeibeamter, die in jenen Anfangsjahren in Fahndungs-, Kontroll- bzw. Festnahme-Situationen erschossen wurden: Herbert Schoner (22. Dezember 1971) während eines Banküberfalls in Kaiserslautern, Hans Eckhardt (22. März 1972)17 * während einer vorbereiteten Festnahme von RAF-Mitgliedern in einer Hamburger Wohnung (2. März 1972) und der Polizeibeamte Pauli (9. Mai 1975) bei einer nächtlichen Personenkontrolle in Köln; dabei ist auch einer der Kontrollierten (Werner Sauber) von einem beteiligten Polizeibeamten erschossen, ein anderer (Karl-Heinz Roth) lebensgefährlich verletzt worden18 * (s.dazu weiter unten).
Im selben Zeitraum von 1971 bis 1980 werden von Polizisten insgesamt 12 Personen erschossen, die wegen des Verdachts verfolgt wurden, Mitglieder oder Unterstützer "Terroristischer Vereinigungen" zu sein19 * - unter ihnen Georg von Rauch (1971), Thomas Weisbecker (1972), Werner Sauber (1975), Willi Peter Stoll (1978), Michael Knoll (1978) und Elisabeth von Dyck (1979).20 *
- Georg von Rauch wurde im Rahmen einer Groß-Fahndungsaktion ("Trabrennen") der Berliner Polizei im Anschluß an eine Verfolgungsfahrt und während einer Personenkontrolle, die gemeinsam von Polizei und Verfassungsschützern am 4. Dezember 1971 durchgeführt worden sind, mit einem Polizeischuß durchs Auge getötet. Dies geschah, als von Rauch bereits mit erhobenen Händen an einer Hauswand gestanden hatte und nach Waffen durchsucht worden war. Dennoch: Das Verfahren gegen den Polizeischützen in Zivil wird rasch wieder eingestellt: "Notwehr".21 *
- Thomas Weisbecker, der in Augsburg bereits von Polizei und "Verfassungsschutz" observiert worden war, wird wenige Stunden, bevor der Polizist Hans Eckhardt am 2. März 1972 in Hamburg erschossen wird, von einem Polizisten auf offener Straße durch einen Herzschuß getötet. Nach Angaben der Polizei soll er versucht haben, seine Pistole zu ziehen; zudem habe er und seine Begleiterin "den Verdacht der Flucht" erweckt, so daß "ein sofortiger Zugriff geboten" war - so der Einstellungsbescheid22 * der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Augsburg, mit dem das Ermittlungsverfahren gegen den Polizeischützen eingestellt wird. Begründung: "Notwehr".23 *
- Willy Peter Stoll wurde am 6. September 1978 in einem Düsseldorfer China-Restaurant von zwei Polizisten erschossen. Das Verfahren gegen die Todesschützen wird ebenfalls eingestellt: "Notwehr". Begründung: Die "allgemein bekannte Gefährlichkeit terroristischer Gewalttäter" rechtfertige den Schußwaffengebrauch - ein verräterisches Argument der Ermittlungsbehörden, das sehr deutlich "gegen eine konkrete Notwehrsituation und für den generellen Vorsatz spricht, Personen, nach denen als Mitglieder der RAF gefahndet wird, zu töten".24 *
Offizielle Stellen und Politiker haben diesen "Fahndungserfolg" gefeiert und den Todesschützen "dienstliche Anerkennung" zuteil werden lassen.25 * Der böse Verdacht, daß hier von seiten der Polizei längst die Strategie des "kurzen Prozesses" eingeschlagen worden sei, die Vollstreckung der vom Grundgesetz für unzulässig erklärten Todesstrafe gleich vor Ort erfolge, dieser Verdacht ließ sich seit jenen Ereignissen für viele besorgte Menschen nicht mehr so einfach von der Hand weisen. Am 9. Juni 1979 wurde der als "Terrorist" verdächtigte Rolf Heissler in einem Haus in Frankfurt festgenommen, das bereits zuvor von Polizeikräften eingehend observiert worden war. Heissler wurde in seiner Wohnung von dort postierten Polizeibeamten erwartet. Beim Betreten der Wohnung schoß ein Beamter Heissler in den Kopf - ohne Vorwarnung und ohne, daß Heissler auch nur den Versuch unternommen hätte, eine Waffe zu ziehen. Nur die Tatsache, daß er im Augenblick des Schusses instinktiv seinen Kopf zur Seite bewegte, ließ ihn überleben. 26 *
Auch mindestens fünf völlig unbeteiligte Menschen fielen im Zuge der "Terroristenfahndungen" in den siebziger Jahren Polizeikugeln zum Opfer: Der in Stuttgart lebende Schotte Ian McLeod (1972) wurde bei einer Hausdurchsuchung nach "Terroristen" in seiner Wohnung erschossen, ebenfalls der Taxifahrer Günter Jendrian (1974) in München von einem Beamten des "Mobilen Einsatzkommandos".27 * Bei Verkehrskontrollen im Rahmen der Terroristenfahndung fanden der 17jährige Lehrling Richard Epple in Tübingen (1972), der Schäfer Helmut Schlaudraff bei Lahn-Wetzlar (1977) und der Schalltechniker Manfred Perder auf der Autobahn bei Neuss (1980) den Tod.28 * Perder war mit seinem Transporter in eine Kontrollstelle gemäß 111 Strafprozeßordnung geraten. Kurz nachdem der Wagen zum Stehen kam, riß einer der Polizeibeamten die Maschinenpistole hoch und schoß Manfred Perder mitten ins Gesicht.
Der damalige Düsseldorfer Regierungspräsident Dr. Achim Rohde (FDP), oberster Dienstherr jener (Bezirks-) Fahndungsgruppe, der der Todesschütze angehörte, schickte Perders Witwe anläßlich der Beerdigung des Polizeiopfers folgendes "taktvolle und mitfühlende" Telegramm:
"Ihnen und Ihren Angehoerigen moechte ich in diesen schweren Stunden mein tiefes Mitgefuehl aussprechen. Der Terrorismus in unserem Lande hat wieder ein unschuldiges Opfer gefunden - die eigentlich Verantwortlichen bleiben im Schatten. Ohne dass es Ihnen Trost sein kann, darf ich Ihnen eine rueckhaltlose Aufklaerung des tragischen Vorgangs ebenso versichern, wie moegliche Hilfen."
Wohlgemerkt: Das unschuldige Opfer wurde von der Polizei, von einem Spezialbeamten des "Mobilen Einsatzkommandos" (MEK) erschossen, nicht etwa von "schießwütigen Terroristen". Die eigentlich Verantwortlichen blieben in der Tat im Dunkeln. Der unmittelbare Täter, der Polizeiobermeister Peter U. wurde wegen fahrlässiger Tötung zu lediglich sieben Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt, konnte also den Polizeidienst weiter versehen.29 *
Das Amtsgericht Neuss, bei dem dieser Fall von der Staatsanwaltschaft, einer "Bagatelle" gleich, angeklagt worden war, stellte in den Urteilsgründen zu den Fahndungsvoraussetzungen und zur Tatsituation folgendes fest:
"Bei der Bezirksfahndungsgruppe ... handelte es sich um eine Polizeieinheit, die speziell zur Terroristenfahndung eingesetzt war. Ihre Mitglieder waren gehalten, solche Fahrzeuge einer Kontrolle zu unterziehen, die einem bestimmten Fahndungsraster, das den mitwirkenden Beamten bekanntgegeben wurde, entsprachen...". Der Transporter des späteren Todesopfers habe, so das Gericht, "an diesem Tag dem vorgegebenen Fahndungsraster der Polizei" entsprochen.
Die Amtsrichterin Eva F. wertete sämtliche Tatumstände fast ausschließlich zu Gunsten des Todesschützen: "Ob der Angeklagte vorsätzlich den Schuß auf den hinter der Windschutzscheibe befindlichen Fahrer abgegeben hat, war nicht festzustellen. Allerdings konnte dies auch offen bleiben. Der Angeklagte hat, ohne daß ihm dies zu widerlegen war, angegeben, daß er zum Schutze seiner eigenen Person und seiner Kollegen gehandelt habe." Es spreche zu Gunsten des Angeklagten, "daß die Tätigkeit als Sicherungsposten ständige Konzentration, Umsicht und Reaktionsbereitschaft verlangt. Eine solche Tätigkeit muß umsomehr die Gefahr von Fehlhandlungen in sich bergen, je weniger für einen Sicherungsposten tatsächlich die Notwendigkeit des Einschreitens besteht. Ein vorwerfbares Fehlverhalten des Sicherungspostens wird dabei zwangsläufig gravierende Folgen zeitigen, das folgt schon aus der Art der Bewaffnung. Dem Angeklagten muß daher sein Versagen, auch wenn es nicht entschuldbar war, strafmildernd zugute gehalten werden, weil es gleichsam tätigkeitsimmanent war".
So viel richterliches Verständnis wird nichtbeamteten Todesschützen wohl kaum zuteil. Urteil: 7 Monate mit Bewährung. Angesichts dieses milden Urteils fragte sich vollkommen konsterniert der Publizist Hanno Kühnert in "Der Zeit": "Sind Menschenleben weniger wert, wenn sie durch Polizeibeamte ausgelöscht werden?" 30 *
Auch der Polizeischütze, der anläßlich einer Polizeikontrolle den Schäfer Helmut Schlaudraff mit einer 9-mm-Kugel aus seiner Maschinenpistole von "Heckler & Koch" aus nächster Nähe in die Halsschlagader getroffen hatte, kam glimpflich davon: 3 Monate mit Bewährung für den Polizeihauptmeister (PHM) Peter B., Leibwächter des ehemaligen BKA-Präsidenten Horst Herold, Schießausbilder und Scharfschütze. Lapidarer Vorwurf: PHM B. habe den Finger an seiner Waffe nicht vorschriftsmäßig "längs des Abzugsbügels gestreckt", sondern "im Abzugsbügel gekrümmt"; er habe damit eine Dienstvorschrift verletzt; im übrigen wurde ihm die "Hektik der Terroristenfahndung" strafmildernd zugute gehalten.
Angesichts der geschilderten Todesschüsse, die im Zusammenhang mit "Terrorismusfahndungen" gefallen waren, warnte die schwedische Tageszeitung "Dagens Nyheter" ihre LeserInnen eindringlich: "Machen Sie bei Polizeikontrollen keine schnellen Handbewegungen, denn man könnte meinen, Sie würden eine Waffe ziehen. Sie riskieren, erschossen zu werden. Denn in letzter Zeit schießt die westdeutsche Polizei sehr schnell."31 *
In den Jahren 1971 bis 1980 sind in der Bundesrepublik insgesamt mehr als 150 Menschen in unterschiedlichen Situationen von Polizeikugeln tödlich getroffen worden - auf frischer Tat, beim Versuch der Festnahme oder auf der Flucht erschossen, vorwiegend also zur Durchsetzung des "staatlichen Strafanspruchs". Durchschnittlich fielen somit Jahr für Jahr etwa 15 Menschen polizeilichen Todesschüssen zum Opfer.32 * Dieser hohe Durchschnittswert hat, auf dem Hintergrund des politischen Klimas der Terrorismushysterie und der inneren Aufrüstung, mehrere Ursachen, die weitgehend in den siebziger Jahren gesetzt worden sind. Dieses hohe Niveau der durchschnittlichen Anzahl polizeilicher Todesschüsse ist im übrigen in den achtziger Jahren weitgehend gleich geblieben (1981 - 1990: knapp 120; 1991 - 1993: 34).
Eine Untersuchung der Todesschußsituationen im Zusammenhang mit Terroristen-Fahndung und Festnahmeaktionen läßt den Schluß zu, daß viele der Todesopfer auf beiden Seiten ohne die damit verbundenen spezifischen Fahndungsmethoden und -hysterien mit großer Wahrscheinlichkeit hätten vermieden werden können. Die von offizieller Seite meist öffentlich gerechtfertigten Fälle auf dem Todesschuß-Konto der Polizei, mitunter als "bedauerliche Einzelfälle" oder gar als "individuelles Fehlverhalten" einzelner "Schwarzer Schafe" ausgegeben, entpuppen sich weitgehend als mitverursacht von Strukturen, Entwicklungstendenzen und Mentalitäten in den Sicherheitsapparaten, die im Laufe der "Terrorismusbekämpfung" einer grundlegenden Veränderung, quantitativ wie qualitativ, unterzogen wurden.
Selbst auf die Gefahr hin, der "Einseitigkeit" geziehen zu werden, möchte ich daher an dieser Stelle in aller erster Linie auf die Ursachen und Bedingungen eingehen, die von staatlicher Seite gesetzt worden sind. Denn auf dieser Seite gab es meines Erachtens Entscheidungs- und Handlungsspielräume, die - anders, rationaler und weniger feindorientiert genutzt - auch Deeskalationsmodelle zuließen, statt die Eskalation per Staatsgewalt zu forcieren. Wesentliche Faktoren, die zu solchen Situationen mit tödlichem Ausgang führten bzw. generell führen können, lassen sich nämlich gerade auf Seiten des Ermittlungs- und Fahndungsapparates und seiner Bediensteten ausmachen (ohne damit die spezifischen Probleme mit einem aufgenötigten bewaffneten Kampf in Abrede stellen zu wollen): Die massive geistige Aufrüstung, die Verinnerlichung von "Sicherheit und Ordnung" als absolutem Wert, dem sich notfalls Menschenleben unterzuordnen haben, die Mobilisierung von Vorurteilen gegen politische und soziale Minderheiten, das Raster von "Gut" und "Böse", die soziale und rechtliche Ausbürgerung von "Rechtsbrechern", die Stilisierung des "Staatsfeindes", geschürte Ängste und Aggressionen nach langjähriger Terroristenhysterie - die Summe dieser und anderer psychosozialer und ideologischer Faktoren zeitigten Auswirkungen weit über den Bereich der "Terrorismusbekämpfung" im engeren Sinne hinaus und zeichnen mitverantwortlich für die erschreckende Todesschuß-Bilanz.
Auf der materiellen Seite sind u.a. folgende Entwicklungen als Bedingungen und Mitursachen festzustellen:33 *
1. Der Aufbau von hart trainierten polizeilichen Sondereinsatzkommandos und Präzisionsschützen-Kommandos für den "Anti-Terror-Kampf" mit geheimpolizeilicher Sonderausbildung und besonderem Schießtraining, dessen Schwerpunkt der gezielte Todesschuß bildet.
Diese für die Neustrukturierung der Polizei seit Beginn der siebziger Jahre charakteristische Spezialisierung und Professionalisierung34 * hat zu einer wahren Inflation von Spezialeinheiten und Sonderkommandos geführt:35 * Zu ihnen gehören, neben anderen, auf Bundesebene die "Sicherungsgruppe Bonn" des Bundeskriminalamtes mit der Spezialabteilung TE (Terrorismus), die weltberühmt-berüchtigte Anti-Terror-Einheit "GSG 9" des Bundesgrenzschutzes sowie auf Länderebene die "Mobilen Einsatzkommandos" (MEK) der Kriminalpolizeien, die "Spezialeinsatzkommandos" (SEK) der Bereitschaftspolizeien und die "Präzisionschützenkommandos".
Diese Entwicklung von Spezialeinheiten, die wegen ihrer Abschottung und von der
Struktur her kaum noch öffentlich zu kontrollieren sind, dehnt den damit
gewählten Vorrang (staats-) gewaltsamer "Lösung"
gesellschaftlicher Konflikte in "notstandsähnlichen" Situationen
weit hinein in Alltagssituationen aus, da diese Einheiten auch außerhalb
der engeren "Terrorismus"-Bereiche zum Einsatz gelangen. Insofern ist
es nicht erstaunlich, daß sich Mitglieder von Spezialkommandos
gelegentlich auch in solchen Fällen als Todesschützen erweisen, die
dem Bereich der "Alltagskriminalität" zuzurechnen sind.36 *
2. Verstärkte Schießausbildung: Insbesondere seit den
Hochzeiten der "Terroristenfahndung" in den siebziger Jahren wurde die
Schießausbildung für Polizeibeamte stark intensiviert. Dabei spielen
sog. Schießkinos eine nicht zu unterschätzende Rolle, in denen realitätsfremde
Action-Szenen simuliert und mit deren Hilfe die Polizeibeamten zu Schnelligkeit
und Zielsicherheit gedrillt werden. Was da letztlich getrimmt wird, ist das
Schießen als Reflex anläßlich einer bedrohlich erscheinenden
Situation - schießen also, ohne zu denken.
Dabei ist das Ziel, mutmaßliche
Straftäter lediglich flucht- oder angriffsunfähig zu schießen,
wie es die meisten Polizeigesetze (noch) vorsehen, immer mehr aus der Mode
gekommen. Insbesondere die Spezialeinsatzkommandos, auf deren Konto sehr viele
Todesschüsse außerhalb der Schießkinos gehen, üben am sog.
"K-5-Bereich": Kopf, Brust und Bauch. "Combat" heißt
die einschlägige Schießart - auch Deutschuß genannt -, die da
intensiv trainiert wird und bei der es darauf ankommt, möglichst schnell zu
feuern - eine Art "ungezielter" Todesschuß also. Aus geheimen
Schießausbildungsunterlagen des Bundeskriminalamtes ("KI 24-2883/2885")
geht hervor, daß den Schützen, vom Ziehen der Waffe an gerechnet, nur
eine Sekunde Zeit pro "Deutschuß aus der Hüfthöhe"
bleibt; als "Mindestleistung" gilt: Von 5 Schüssen "3
Treffer im Figurenbereich (ohne Arme und Beine)"37 *. Da bleibt
keine Zeit für Skrupel und zum Nachdenken, was im Training schließlich
auch systematisch abgebaut werden soll.38 * Zum Trainingsprogramm
beispielsweise der GSG 9 gehört es darüber hinaus, "Fluchttäter"
mit Hubschraubern zu verfolgen und aus den geöffneten Türen der
Maschinen gezielt auf sie zu schießen. Die "Trefferquote" liegt,
wie der GSG-9-Experte Rolf Tophoven nicht ohne Stolz berichtet, bei solchen Einsätzen
bei 85 Prozent.39 * Anfang der achtziger Jahre wurde eine neue Schießausbildung
für die bundesdeutsche Polizei getestet und trainiert: die "Survival-(Überlebens-)Schießtechnik".
Folgt man den Anweisungen des Scharfschützen und Schießausbilders
Siegfried Hübner, waffentechnischer Berater der Polizei, so ist eine "aggressive
Grundhaltung" unerläßlich - denn, so seine "Gebrauchsanleitung"
wörtlich, "um zu überleben, müssen Sie gnadenlos schnell...
handeln. Sie müssen so gut treffen, daß Ihre Gegner nicht mehr auf
sie schießen können". Geraten wird den schießenden
Polizisten, in entsprechenden Situationen einen "Angriffsschrei"
loszulassen: Dieser erschrecke nicht nur den Gegner, sondern drücke auch
die Luft aus dem Magen, "was eine Magenverletzung ungefährlicher macht",
und bewirke zugleich "einen Adrenalinstoß", der den Polizeischützen
enthemmt und seine "Aggressivität steigert"40 *.
Die geschilderte Konditionierung hat die Polizeibeamten, insbesondere die Angehörigen
von Spezialkommandos, stärker als zuvor darauf fixiert, in unübersichtlichen
und bedrohlich erscheinenden (Alltags-) Situationen reflexartig zu schießen.
3. Gesetzliche Herabsetzung der Hemmschwelle zum gezielten Todesschuß:
Mitte der siebziger Jahre ist von der "Innenministerkonferenz" der
Versuch gestartet worden, über den sog. Musterentwurf (ME) für ein
einheitliches Polizeigesetz des Bundes und der Länder41 * u.a. den
gezielten Todesschuß (auch verharmlosend "finaler Rettungsschuß"
genannt), selbst auf Kinder unter 14 Jahren zu legalisieren. Dieser
Musterentwurf diente für alle Bundesländer unmittelbar als Vorbild für
die eigene Polizeigesetzgebung.
Das war der Startschuß zur
bundesweiten Legalisierung des gezielten Todesschusses. Bislang durfte nach den
Polizeigesetzen der Zweck des Schußwaffengebrauchs nur sein, Personen, die
etwa einer Straftat dringend verdächtig sind, "angriffs- oder
fluchtunfähig" zu machen, nicht jedoch, vorsätzlich zu töten.
Nun sollte der gezielte Todesschuß ("Ein Schuß, der mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken wird") zulässig
werden, "wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen
Lebensgefahr", aber auch einer "gegenwärtigen Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unversehrtheit ist" (41
Abs. 2 ME).
Mit dieser Normierung, so die damalige, heute noch gültige
Kritik an der Legalisierung des gezielten Todesschusses, werde die vom
Grundgesetz mit guten Gründen abgeschaffte Todesstrafe42 *
praktisch durch die Hintertür wieder eingeführt und gleich vor Ort,
ohne langen (Gerichts-) Prozeß, vollstreckt. Eine solche staatliche
Disposition über menschliches Leben, quasi die letzte, zielgerichtet tödliche
Konsequenz des staatlichen Gewaltmonopols, dürfe es nicht geben. Außerdem
bestehe die Gefahr, daß durch eine solche Ermächtigung zum gezielten
Todesschuß als staatlichem Hoheitsakt auch die Hemmschwelle zum
polizeilichen Schußwaffengebrauch und zum Töten im staatlichen
Auftrag drastisch herabgesetzt werde.43 *
Der gezielte, also vorsätzliche
Todesschuß wäre in bestimmten Situationen durch ein solches Gesetz
von vornherein für rechtmäßig erklärt ("Ermächtigungsgrundlage")
und unterläge grundsätzlich nicht mehr der (straf-) gerichtlichen
Kontrolle: Der Todesschütze müßte sich also nicht mehr, wie
bisher, individuell, etwa mit "Notwehr", rechtfertigen, denn was
(polizei-) gesetzlich abgesichert ist, bedarf keiner Rechtfertigung im
strafrechtlichen Sinne. Im übrigen kann der gezielte Todesschuß dann
auch, ist er erst legalisiert, dem einzelnen unmittelbar handelnden
Polizeibeamten, selbst gegen dessen Willen, befohlen werden - er könnte
sich nur bei Strafe eines Disziplinarverfahrens verweigern. Töten also auf
Befehl. "Wer den Schußwaffengebrauch ablehnt, darf nicht Polizist
werden", kommentiert der führende Polizeirechtler Mertens, der
herrschenden Meinung folgend: "In Extremsituationen kann sich der Staat
wegen seiner Pflicht zum Schutz der vitalen und fundamentalen Güter seiner
Bürger den Luxus von Gewissensentscheidungen der Polizeibeamten nicht
leisten.44 *"
4. Das Problem der "Eigensicherung":
Zur Problematik unkontrollierbarer Spezialeinsatzkommandos, zur Konditionierung
durch das Schießtraining und zu den Auswirkungen gesetzlicher (Todes-)
Schußregelungen kommt noch das Problem der sog. Eigensicherung hinzu. Sie
ist zentraler Bestandteil der Polizeiausbildung und wurde in fast schon extrem
zu nennendem Maße gepflegt. Die Frage lautet: Wie schützt sich der
Polizeibeamte vor allüberall lauernden Gefahren?
Was sich hinter der
recht harmlos klingenden "Eigensicherung" verbirgt, erweist sich als
systematisches Bestreben der Polizeiführungen, ihre Beamten in ständige
Alarm- und Kampfbereitschaft zu versetzen. Zu den obersten Grundsätzen gehört
es: "Argwohn wachhalten und nie in der Aufmerksamkeit nachlassen... im
Zweifelsfall immer das Schlimmste annehmen... alle verfügbaren technischen
Hilfsmittel nutzen."45 * Auf Plakaten in Polizeirevieren ist zu
lesen: "Führe Deine Dienstwaffe immer mit. Halte sie griffbereit.
Vorsicht bei Nacht! Vorsicht an einsamen und verdächtigen Orten. In der
Routine lauert Gefahr! Also: sei mißtrauisch. Vorherige Absprache!
Gegenseitige Sicherung. Achte auf günstige Sicherungsposition! Sicht! Schußfeld!
Deckung..." Im amtlichen "Leitfaden 371: Eigensicherung im
Polizeidienst",46 * der als "Verschlußsache - Nur für
den Dienstgebrauch" eingestuft ist, heißt es dann - zunächst
allgemein: "Es ist notwendig, bestimmte Verhaltensweisen der Eigensicherung
einzuüben und ständig zu trainieren... Bleiben Sie ... wachsam und
rechnen Sie bei jedem Einsatz von Anfang an mit Gefahren! Sie können sonst
Opfer unangebrachter Vertrauensseligkeit werden... Auch harmlos erscheinende
Personen können sich plötzlich als gefährlich erweisen und
unvermittelt angreifen... Sie müssen Ihre Schußwaffe blitzschnell
einsetzen können. Halten Sie deshalb die Schußhand möglichst
frei!".
Zur Durchführung von Verkehrs- und Identitätskontrollen
heißt es weiter:
"Es ist stets daran zu denken, daß die
Fahrzeuginsassen Straftäter sein können. Deshalb dürfen Sie bei
Kontrollen nicht arglos sein... Das Erscheinungsbild der zu kontrollierenden
Personen kann trügen. Auch der bei einem harmlosen Anlaß Angetroffene
kann gewalttätig werden. Der Griff zum Ausweis kann einer Waffe gelten...
Verhalten Sie sich stets so, daß Sie auf einen Überraschungsangriff
sofort reagieren und notfalls Ihre Schußwaffe blitzschnell ziehen können".
"Jede Bewegung kann der Vorbereitung eines Angriffs dienen". Diese
Zitate sind eindrucksvolle Belege für die Aufbereitung einer ständigen
Bedrohungssituation, in der der lebensbedrohliche Polizei-Griff zur Schußwaffe
als Routinehandlung antrainiert wird und Putativ- bzw. Präventiv-Erschießungen
vorprogrammiert werden. Diese Art von "Eigensicherung" ist Bestandteil
polizeilichen Einsatzbewußtseins geworden - in Ausnahmesituationen, aber
auch immer mehr im Alltag. Die polizeilichen Todesschüsse im Zusammenhang
mit Kontrollen legen trauriges Zeugnis ab über die Wirkungen solcher
Konditionierung und Angstmacherei.
5. Diese permanente Suggerierung einer
allgegenwärtigen Bedrohung steht in eigenartigem Kontrast zur realen
Bedrohung von Polizeibeamten.47 * Tatsächlich sind in der Zeit von
1971 bis 1980, also in zehn Jahren, von den etwa 200.000 Polizeibeamten
insgesamt 65 Polizisten in unterschiedlichen Situationen im Dienst getötet
worden;48 * diese Zahl umfaßt sämtliche Todesarten, also
nicht nur Erschießungen, sondern auch etwa tödliche Verkehrsunfälle.
Vergleicht man dies mit der Zahl der von Polizeibeamten erschossenen Menschen -
in derselben Zeit 153 - und zählt man die auf andere Weise von Polizisten
getöteten Bürger hinzu - etwa durch Auto-Verfolgungsjagden oder Erwürgen
-, was eine Zahl weit über 200 Todesopfer ergibt, so wird der jeweilige Gefährdungsgrad
deutlich.
Zur Frage, wie gefährlich sich der Polizeiberuf tatsächlich
darstellt, das heißt, wie hoch das Risiko für Polizeibeamte ist, im
Dienst getötet zu werden, kommen die Polizeiforscher Albrecht Funk, Falco
Werkentin und Angelika Thies zu einem erstaunlichen Ergebnis: Sie haben nämlich
anhand von Zahlenmaterial der Berufsgenossenschaften die durch Unfälle und
Berufskrankheiten verursachten Todesfälle für spezielle Berufszweige
ermittelt und herausgefunden, daß das Berufsrisiko der Vollzugsbeamten in
den sechziger und siebziger Jahren "auf einem unteren Rangplatz" lag -
vergleichbar dem von Feinmechanikern und Elektrikern.49 * Verglichen mit
anderen Berufsgruppen entsprach das Berufsrisiko der Polizisten Anfang der
achtziger Jahre "dem der Kellner und Köche und dem von
Lagerarbeitern... Bergarbeiter waren knapp sechsmal stärker gefährdet,
Seeleute fünfmal und auch Berufskraftfahrer waren noch doppelt so gefährdet
wie Polizeibeamte. In der Summe zeigt sich, daß es wenige Berufe gibt, in
denen man vor Todesrisiken so relativ geschützt ist wie im Polizeidienst."
50 *Auch im internationalen Vergleich bestätigt sich diese
Erkenntnis: In einer Reihe von 11 europäischen Ländern steht die
bundesdeutsche Polizei mit dem drittgeringsten Polizeiberufsrisiko..51 *
Damit den Polizeibeamten jedoch trotz der entgegen dieser Erkenntnisse
erfolgenden Suggestion und Autosuggestion einer allgegenwärtigen Bedrohung
das Handwerk nicht vollkommen vermiest werde, können sie einem ihrer frühen
Polizei-Lehrbücher ("Kleine Polizeigeschichte")52 *
folgende kleine moralische Aufmunterung entnehmen:
"Wer Polizeibeamter
wird, muß sich darüber klar sein, daß er nicht nur einen außerordentlich
schweren, sondern auch einen besonders schönen Beruf erwählt hat...
schön, weil... er überall und jederzeit Sicherheit und Ordnung verbürgen
muß, und weil er das Recht hat, mit fester Hand und, wenn es nötig
ist, auch mit Waffengewalt diejenigen unschädlich zu machen, die die
sittlichen Grundsätze unseres Gesellschaftslebens mißachten."
Die gerichtliche Bewältigung der Todesfälle im Zusammenhang mit
der "Terrorismusbekämpfung" trug den genannten Umständen und
exekutiven Bedingungen in keiner Weise Rechnung: Die apparativen, strukturellen
und mentalen Ursachen blieben in aller Regel unberücksichtigt, die
eigentlich politisch und fachlich Verantwortlichen ungeschoren - auch dies ein
nicht unwesentlicher Aspekt Politischer Justiz im Staatsinteresse: Regelmäßig
wurden die "schießwütigen Terroristen" wegen Mordes oder
Mordversuchs angeklagt, wobei eine Vielzahl der langjährigen sowie
lebenslangen Freiheitsstrafen Ergebnis gerade solcher Verfahren ist.53 *
Dieses Bild skrupelloser Mörder ist von Anfang an systematisch entworfen
worden. Es bildete die Grundlage der öffentlichen Feindbildproduktion und
der Terrorismushysterie und konnte auch nicht ohne Einfluß auf die bei
Fahndungen eingesetzten Polizisten bleiben.
Bereits die ersten Kontroll-
und Festnahme-Situationen sowie die darauf bezogenen Anklagekonstruktionen und
Entscheidungen der Strafgerichte Anfang der siebziger Jahre, in denen über
die strafrechtlichen Folgen der bewaffneten Auseinandersetzungen befunden wurde,
prägten jenes Bild von den skrupellosen Mördern bis hinein in die späteren
Strafverfahren und verankerten es - über die Sensationsmedien - in den Köpfen
der Bevölkerung. In der Regel sind die Massenmedien nicht erst prozeßbegleitend,
sondern gleich von Anfang an in die Strategien der Ermittlungsbehörden
einbezogen worden. Ein früher Fall von Medienkampagne, der die weitere
Geschichte nicht unwesentlich geprägt hat, führt uns zu einer ganzen
Reihe von staatsschützerischen Abgründen:
"Apo-Mädchen
schoß sich den Weg frei", titelte die Bild-Zeitung am 12.
Februar 1971 in großen Lettern, "Astrid Proll schießt sich den
Weg frei", überschreibt in auffälliger Übereinstimmung die "seriöse"
Frankfurter Allgemeine Zeitung am selben Tag ihren Artikel über
eine "Schießerei" im Frankfurter Westend zwei Tage zuvor. Die Blätter
stützten sich bei ihrer Berichterstattung auf Informationen der Polizei.
Was war tatsächlich geschehen? Polizei und "Verfassungsschutz"
hatten eine gemeinsame gezielte Fahndungsaktion unternommen. Im Visier der
Staatsschützer: Astrid Proll und Manfred Grashof, die der "Baader-Meinhof-Bande"
zugerechnet werden. Der Verfassungsschutzbeamte Michael Grünhagen und der
BKA-Kriminaloberkommissar Heinz Simons stellen das Paar zur "Ausweiskontrolle".
Daraufhin soll Grashof eine Pistole gezogen haben. Die beiden können
fliehen. Simons versucht noch, die Flucht zu verhindern, indem er den Flüchtenden
hinterherschießt. Vergeblich.
Der Journalist Stefan Aust schildert
die unglaublichen Folgen dieser Begebenheit in komprimierter Form:54 *
"Die Schießerei ... wurde mehr als zweieinhalb Jahre später
zum Hauptanklagepunkt gegen Astrid Proll: Mordversuch, sie habe auf die Beamten
geschossen. Schon im ersten Verfahren kamen Zweifel an der Glaubwürdigkeit
der beiden Beamten auf, zu groß waren die Widersprüche in ihrer
Schilderung des Tathergangs. Aber erst im zweiten Proll-Prozeß - die
Angeklagte war inzwischen aus gesundheitlichen Gründen freigelassen worden
und hatte sich nach England abgesetzt, war dort aber wieder festgenommen worden
- wurde die Mordversuch-Anklage gegen sie fallengelassen. Es waren nämlich
noch weitere Beamte am Schauplatz gewesen, Mitarbeiter des Bundesamtes für
Verfassungsschutz. Sie hatten in einem Aktenvermerk festgehalten, daß
Astrid Proll nicht geschossen hatte (ja, gar nicht schießen konnte, weil
sie unbewaffnet war; R.G.). Das entlastende Verfassungsschutzpapier wurde erst
acht Jahre nach dem Vorfall an das Gericht gegeben."
Die Vorsitzende
Richterin Johanna Dierks beschuldigte in diesem Zusammenhang die Exekutive, "in
eklatanter Weise in die Rechtsprechung eingegriffen" zu haben:55 *
Akten und Zeugenaussagen sind von den Sicherheitsorganen schamlos manipuliert
worden, Aussagegenehmigungen für beamtete Zeugen behördlich verweigert
oder aber beschränkt, "geheime" Entlastungszeugen dem Gericht von
den Exekutiv -behörden "unterschlagen" (Dierks) worden.56 *
Daß Astrid Proll nicht geschossen hatte, mußte den Sicherheitsbehörden
also von Anfang an bekannt gewesen sein. Aber sie hielten diese Wahrheit
jahrelang unter Verschluß und verfolgten wissentlich, was den Vorwurf des
(zweifachen) "Mordversuchs" anbelangt, eine Unschuldige, die in
strenger Isolationshaft bis zu ihrer Haftunfähigkeit nicht zuletzt deswegen
in unmenschlicher Weise leiden mußte; das zu erwartende Strafmaß für
Mordversuch: bis zu lebenslänglich. Und sie munitionierten wahrheitswidrig
die Massenmedien in ihrem Sinne:57 * "Astrid Proll schießt
sich Fluchtweg frei" (FAZ). "Auch ihr Freund feuerte auf die
Polizisten" (Bild), "schossen sich den Weg frei" (Frankfurter
Rundschau). "Feuergefecht mit Baader-Bande" (Die Welt).
"Die Frankfurter Polizei sagt, alle seien bewaffnet und machten rücksichtslos
von der Schußwaffe Gebrauch" (FAZ). Seit dieser frühen
Instrumentalisierung der Medien durch die Ermittlungsbehörden kursieren die
bösen Worte vom "rücksichtslosen" Schußwaffengebrauch
und den "schießwütigen Terroristen". Solche "Zombies"
wurden in jenen Tagen und Wochen, aber auch später noch, staatlicherseits
geradezu produziert sowie ihre Verfolgung bzw. Festnahme öffentlich
zelebriert. In unmittelbarem Zusammenhang mit dem erwähnten manipulierten
Ereignis wurde die erste große bundesweite Fahndungsaktion gegen die "Baader-Meinhof-Bande"
in die Wege geleitet. Weitere folgten. Nicht gerade selten mit tödlichem
Ausgang, wie etwa drei Monate später, als Petra Schelm von einem Polizisten
erschossen wurde. Bei der Aufarbeitung solcher Ereignisse gehörten
exekutive Manipulationen fast schon zur Gewohnheit.
Fünf Jahre später,
am 9. Mai 1975, kam es in Köln im Zuge einer Polizeikontrolle zu einer
Schießerei zwischen einem Polizisten und dem Beifahrer des kontrollierten
Fahrzeuges. Bei der Überprüfung der Personalien hatten die
Polizeibeamten zuvor über Funk erfahren, daß es sich bei einem der
Kontrollierten möglicherweise um einen "Anarchisten" respektive "Terroristen"
handele. Daraufhin kam es zu einer Schießerei, in deren Verlauf der
Beifahrer, Werner Sauber, und der Polizeibeamte Pauli getötet wurden. Der
Fahrer des PKW, der Arzt Karl-Heinz Roth, und ein weiterer Polizeibeamter wurden
lebensgefährlich verletzt. Der am Boden liegende Roth und der dritte
Wageninsasse, Roland Otto, wurden anschließend widerstandslos
festgenommen.
Ihnen wurde der Mordprozeß gemacht. Und abermals hatte
die Polizei bereits im Vorfeld Falschmeldungen in Umlauf gesetzt. Wieder haben
die Massenmedien auf dieser Basis die "anarchistischen Gewalttäter"
als gerissene und gewissenlose Killer, als Mörder aufgebaut und
vorverurteilt. Wieder haben Polizei und Staatsanwaltschaft Verfahrensunterlagen
manipuliert, haben Polizeizeugen die Wahrheit unterdrückt, um den
Mordvorwurf aufrechterhalten zu können. Diesmal ließ sich das Gericht
zwar weitgehend in die exekutive Behinderung der Verteidigung der Angeklagten
einbinden, aber am Ende des Verfahrens, zwei Jahre nach dem Ereignis, mußten
Roth und Otto von der Mordanklage freigesprochen werden. Das Verfahren hat sich
in eine Anklage gegen die Ermittlungsbehörden verkehrt. Den Angeklagten und
ihrer Verteidigung ist es gelungen, die Schießerei wahrheitsgetreu zu
rekonstruieren: Weder Karl-Heinz Roth, noch Roland Otto hatten auf die
Polizeibeamten geschossen.
Noch ein Beispiel: Der Prozeß gegen
Detlef Sch., angeklagt des Mordes an einem Polizeibeamten. Der Angeklagte, der
der "Terrorszene" zugerechnet worden war, soll in Begleitung von zwei
unbekannt gebliebenen Männern am 7. Mai 1976 den Polizisten Fritz S. während
einer Polizeikontrolle in Sprendlingen bei Darmstadt im Laufe einer Schießerei
erschossen haben. Erst nach zwei Jahren, am Ende des Verfahrens gegen Sch. gab
die Polizei zu, was sie von Anfang an wissen konnte: daß der erschossene
Fritz S. von einer Polizeikugel, Kaliber 7,65 mm, getötet worden war - aus
der Dienstwaffe seines Polizeikollegen Rolf K.58 * Ein zweiter Schuß
konnte ebenfalls nicht von Detlef Sch. stammen. Folgerichtiges Urteil:
Freispruch.
Auf dieser Basis exekutiv produzierter Mörder und justiziell
fabrizierter Mordurteile konnte auf der anderen Seite den "final"
schießenden Polizisten in den weitaus meisten Fällen von vornherein
Rechtfertigungsgründe zugebilligt werden. Weitaus die meisten der
eingeleiteten staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren gegen polizeiliche
Todesschützen werden denn auch eingestellt oder enden mit einem Freispruch:
1. Entweder weil der Beamte nach Polizeirecht oder den Dienstvorschriften ("Ermächtigungsgrundlagen")
schießen und töten durfte;
2. oder weil der Todesschütze
in Notwehr handelte: das spätere Todesopfer habe ihn zuvor bedroht ("Begründung"
in den Fällen Schelm, von Rauch, Weisbecker, Jendrian, Stoll) - ein
die Rechtswidrigkeit der Tat ausschließender "Rechtfertigungsgrund",
der Polizeibeamten als Träger hoheitlicher Gewalt ebenso wie ganz normalen
Bürgern zugestanden wird. Selbst im Fall der Elisabeth von Dyck wurde dem
Todesschützen "Notwehr" zugebilligt,59 * obwohl das Opfer
durch einen Schuß in den Rücken ums Leben kam - abgefeuert von einem
Polizeibeamten (Nr. 24), der in einer vorbereiteten Aktion zusammen mit anderen
Mitgliedern eines Spezialeinsatzkommandos dem späteren Opfer in dessen
Wohnung aufgelauert hatte. Die beteiligten Polizeibeamten wurden für ihren
Einsatz bestens vorbereitet, wie sich aus dem erwähnten
Einstellungsbescheid ergibt:60 * Im Einsatzbefehl waren sie eindringlich
darauf hingewiesen worden, daß die zur Festnahme ausgeschriebenen Personen
"regelmäßig Schußwaffen, möglicherweise auch
Sprengmittel, mit sich führen und mit einem rücksichtslosen Schußwaffengebrauch
zu rechnen sei... Aus Gründen der Eigensicherung sollte die Festnahme mit
schußbereiten Waffen erfolgen."
3. Wenn nun beim besten Willen
keine Notwehrsituation konstruierbar erscheint, dann mag der Polizeischütze
zumindest Umstände angenommen haben, die eine tödliche "Notwehrhandlung"
entschuldigen, obwohl tatsächlich keine objektive Gefahr bestanden hat ("Schuldausschließungsgrund").
Das nennt sich dann "vermeintliche" - oder Putativ-Notwehr: Zum Beispiel habe das Opfer eine "verdächtige" Bewegung gemacht, obwohl es tatsächlich unbewaffnet war. So geschehen im Fall Ian McLeod, der in seiner Stuttgarter Wohnung von Polizisten mit einem Schuß in den Rücken erschossen wurde, obgleich er völlig nackt und unbewaffnet war. Die Staatsanwaltschaft ließ sogleich verlauten, der Beamte habe in Putativ-Notwehr gehandelt; schließlich sei die Durchsuchungsaktion im Rahmen einer Fahndung nach terroristischen Gewalttätern erfolgt. 61 * Der schießende Polizist braucht nur genügend Vorstellungskraft, um sich, als letzte Rettung, eine tatsächlich nicht vorhandene Notwehrsituation einzubilden und dies dem Gericht plausibel zu machen. Typisch hierfür ist der von dem früheren Bereitschaftspolizisten Rainer Buchert in seinem Buch "Zum polizeilichen Schußwaffengebrauch" (1975) 62 * geschilderte Fall der Erschießung des Mopedfahrers Duifhus am 4. Februar 1972 in Duisburg: "Der Mann war nach einem Verkehrsverstoß vor einer Funkstreife geflüchtet. Als ihn ein 21jähriger Polizist mit gezogener Pistole stellte und "Hände hoch" rief, nahm er die Hand aus der Hosentasche. Der Beamte fühlte sich bedroht, schoß und traf den Verkehrssünder tödlich."
4. Bei den berüchtigten Fällen, in denen Straftat-Verdächtige "auf der Flucht erschossen" werden, scheidet "Notwehr" oder "Putativnotwehr" allerdings in der Regel von vornherein aus. Zwar ist der Schußwaffengebrauch gesetzlich u.a. zulässig zur Vereitelung der Flucht - wenn sich also eine Person der Festnahme oder Feststellung ihrer Person durch Flucht zu entziehen versucht. Doch sie darf nach den Polizeigesetzen dabei lediglich "fluchtunfähig" geschossen werden.
Aber selbst in solchen Fällen, in denen das "Fluchtunfähigmachen" dann doch tödlich endet, nimmt ein Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs (BGH)63 * aus dem Jahre 1975 dem Polizeiapparat sowie den einzelnen Staatsschützen auch bei Todesschüssen auf Flüchtende die Verantwortung weitgehend ab. In seinem Urteil hob der BGH die Verurteilung des Polizeihauptkommissars Wolf D. in erster Instanz auf, der im Jahre 1973 den unbewaffneten 17jährigen Fürsorgezögling Erich Dobhardt hinterrücks auf der Flucht erschossen hatte. Begründung: Der "Schußwaffengebrauch zum Zwecke der Wiederergreifung eines flüchtenden Rechtsbrechers" sei gerechtfertigt, wenn von diesem "eine nicht unerhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht". Davon ist, das sei nebenbei erwähnt, bei "Terrorismus"-Verdächtigen generell auszugehen, wenn schon die folgenden Kriterien, die der BGH aufstellt, ausreichend sein sollen: Der erschossene Jugendliche habe wiederholt "Nahrungs- und Genußmittel, Kofferradios, Schallplattengeräte und Bargeld entwendet. In vier Fällen stahl er auch Fahrräder. Er hatte sich, auf frischer Tat getroffen, gewaltsam losgerissen und war geflohen... Die öffentliche Sicherheit erforderte deshalb seine unverzügliche Wiederergreifung ... angesichts der Gefahr, die für die Allgemeinheit von diesem jugendlichen Rechtsbrecher ausging... die Abgabe eines gezielten Schusses auf das Bein des Flüchtenden war auch nicht deshalb unzulässig, weil sie mit dem Risiko der Tötung behaftet war".
Im Klartext: Der Schußwaffengebrauch gegen flüchtende "Rechtsbrecher" - oder Leute, die von der Polizei dafür gehalten werden - ist fast immer gerechtfertigt, weil die Durchsetzung des staatlichen "Strafanspruchs" nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung offenbar einen besonders hohen Wert darstellt, dem das Leben unterzuordnen ist. Der Tod wird also in solchen Fällen auch gerichtlicherseits "billigend in Kauf genommen". Der Todesschütze war "auf Kosten der Staatskasse freizusprechen". Die Folgen dieser gesamten Rechtfertigungs- und Schuldausschließungssystematik lassen sich statistisch abbilden. Eine Untersuchung der Berliner Polizeiforscher Walter und Werkentin über die "justitielle Kontrolle polizeilicher Todesschüsse" in unterschiedlichen Situationen kommt zu folgendem, signifikanten Ergebnis64 *: Von 59 Todesschuß-Situationen mit 63 Todesfällen als Folge polizeilichen Schußwaffengebrauchs endeten in der Zeit zwischen 1980 und 1984 insgesamt 76 Prozent der (Vor-) Ermittlungsverfahren ohne Anklageerhebung. Lediglich 14 Situationen, also etwa 24 Prozent, unterlagen der gerichtlichen Überprüfung, von denen 4 Fälle mit einem Freispruch endeten und in 10 Fällen die Angeklagten letztinstanzlich verurteilt wurden. Neben drei Geldstrafen wurden 7 Haftstrafen zur Bewährung ausgesprochen, so daß - entsprechend der Regelungen in den Beamtengesetzen65 * - in keinem einzigen Fall ein Polizist wegen tödlichen Schußwaffeneinsatzes den Dienst quittieren mußte. Nur ein Urteil lautete über ein Jahr auf Bewährung.
Eine gerichtliche Kontrolle der exekutiven Staatsgewalt, von Polizeihandeln und seinen spezifischen Bedingungen, fand und findet in der Bundesrepublik kaum statt 66 *- auch oder gerade nicht, wenn es sich um Todesschuß-Fälle handelt.
Wie wir gesehen haben, ist das Problem der polizeilichen Todesschüsse jedoch nicht allein ein individuelles, allein in der Person des Todesschützen liegendes Problem, sondern wesentlich mehr: Die streckenweise mörderischen Fahndungspraktiken einer nicht selten paramilitärisch ausgebildeten, ausgerüsteten und vorgehenden Polizei sowie ihre politischen Vorgaben sind allerdings nur äußerst selten Themen der Gerichtsverhandlungen. Das individualisierende Gerichtsverfahren ist von seinem Ansatz her offensichtlich nicht geeignet, die bürokratischen Strukturen und Handlungsmuster, um die es eigentlich geht, zu erfassen und als (mit-)verantwortlich für polizeiliches Handeln zu erkennen und zu be- bzw. verurteilen - was allerdings auch den Todesschützen zugute kommt, die sich "hinter einer organisierten Verantwortungslosigkeit und dem Schutzschild der Amtsautorität zurückziehen können".67 * So ist beispielsweise in einem Urteil der 53. Strafkammer des Landgerichts Berlin zu lesen:68 * "Zugunsten des Angeklagten wurde ferner berücksichtigt, daß er ... im Rahmen der Fortbildungslehrveranstaltungen eine zwar im Rahmen der geltenden Bedingungen liegende, zum Schußwaffengebrauch aber eher ermunternde als Zurückhaltung empfehlende Ausbildung erhalten hat, für die er nicht verantwortlich ist..."
Ungemein erschwerend kommt noch hinzu, daß in jenen polizeilichen Tätigkeitsfeldern, mit denen wir es hier zu tun haben, selbst die Durchsetzbarkeit der gerichtlichen Kontrolle in bezug auf die angeklagten Individuen und die ihnen vorgeworfenen Taten ganz besondere Probleme bereitet:
1. Die meisten Todesschützen bei der Polizei, so die Erfahrung, erleiden nach ihrer Tat einen "Schock" und sind mitunter wochenlang "vernehmungsunfähig" - dokumentierbar etwa im Fall Manfred Perder, aber auch in vielen anderen Fällen. Für sie gibt es in solchen Situationen Sonderrechte:
"Wurde bei einem Schußwaffengebrauch eine Person verletzt oder getötet, so ist dem Beamten Gelegenheit zu geben, von dem Vorfall Abstand zu gewinnen. Dabei ist er von seinem Dienstvorgesetzten, dessen Vertreter oder einem anderen Beamten des gehobenen oder höheren Dienstes zu betreuen."
So sieht es beispielsweise eine interne Dienstanweisung des Polizeipräsidiums München aus dem Jahre 1975 (novelliert 1979) vor, wie sie in ähnlicher Form auch in anderen Großstädten und Bundesländern existiert. Mit "normalen" Bürgern, die in eine Schießerei verwickelt sind, verfährt die Polizei ganz anders: Sie werden auf der Stelle verhört, oft stundenlang, und in Untersuchungshaft gesteckt.
Die Staatsanwaltschaften und Gerichte zeigen meist bemerkenswertes "Verständnis" für solche Sonderrechte, obwohl sie eigentlich mißtrauisch sein müßten: Das ruhige Überdenken der Tat unter "Betreuung" durch Vorgesetzte dient mit Sicherheit nicht dem rechtsstaatlichen Anspruch der Öffentlichkeit auf eine rückhaltlose Aufklärung derart gravierender und folgenschwerer Staatseingriffe.69 *
2. Diese polizeiliche "Täterbetreuung" findet im Gerichtsverfahren ihre Entsprechung in einer intensiven polizeilichen Zeugenbetreuung. Es gibt zahlreiche Hinweise und Belege, daß Polizeibehörden gezielte Versuche unternehmen, auf entsprechende Gerichtsverfahren in ihrem Sinne einzuwirken. Bei verschiedenen Strafprozessen in mehreren Bundesländern konnte aufgedeckt werden, daß Polizeizeugen auf ihre Aussagen durch eigens abgestellte Polizeibeamte gezielt vorbereitet wurden. Die Vorbereitung umfaßt insbesondere das Verhalten vor Gericht mit dem Ziel, Widersprüche in den polizeilichen Aussagen frühzeitig zu tilgen (häufig allerdings ohne Erfolg). Folgende Mittel sind dabei gebräuchlich:
- Ermöglichung von Akteneinsicht, auch bezüglich von Aussagen anderer Zeugen mit der Möglichkeit der inhaltlichen Abstimmung - entgegen dem strafprozessualen Grundsatz, daß sich Zeugen nicht miteinander absprechen dürfen;
- Besprechung des Akteninhalts mit Kollegen und Vorgesetzten in Hinblick auf bevorstehende Zeugenaussagen sowie
- prozeßtaktische Ratschläge.
So bestätigte beispielsweise ein Hamburger Polizeizeuge vor Gericht solche Praktiken:
"Wir vier Beamte setzten uns zusammen und schrieben gemeinsam einen Bericht, den der Kollege W. dann später unterschrieben hat. Zwischendurch kam öfters der Zugführer ins Zimmer und sagte uns Einzelheiten, die wir nicht wissen konnten. Diesen Bericht habe ich vor meiner Aussage im Prozeß durchgelesen, nachdem ich Hinweise für das allgemeine Verhalten vor Gericht bekommen hatte...70 * Ich kann heute nicht mehr trennen, was ich aus Erinnerung weiß und was und ob ich es nur aus dem Lesen der Berichte weiß."
Nicht zufällig stimmen also sehr häufig Berichte mehrerer Polizeibeamter zu einem Vorfall wortwörtlich bzw. in bestimmten markanten Redewendungen überein. Der Hamburger Strafverteidiger Uwe Maeffert, dem das Verdienst zukommt, in mühsamer Kleinarbeit dem System der polizeilichen Zeugenbetreuung auf die Spur gekommen zu sein, spricht in diesem Zusammenhang ungeschminkt von "Zeugenpräparierung", von "administrativer Manipulation" des Strafprozesses, kurz: von "Prozeßtheater".71 *
3. Ein weiteres Kontrollerschwernis, besser: -hindernis ist zu verzeichnen: So wird etwa die Identität schießender Polizisten mitunter den Angehörigen der Todesopfer und sogar den Gerichten gegenüber geheimgehalten, wie etwa im Fall der Elisabeth von Dyck. Im Fall des als Terrorist beschuldigten Rolf Heissler,72 * der am 9. Juli 1979 von Polizisten mit einem Kopfschuß schwer verletzt worden war, sind die Namen der beteiligten Polizeibeamten von den Behörden ebenfalls nicht bekanntgegeben, ihre Vernehmung unter Code-Nummern (Beamter Nr. 1245, Nr. 5050) vorgenommen worden. Heisslers Anwalt, der die Anklage gegen die Polizeischützen im Wege des sogenannten Klageerzwingungsverfahrens erreichen wollte, konnte folglich in seinem Antrag die Namen der mutmaßlichen Täter nicht nennen. Dies nahm das Oberlandesgericht zum Anlaß, den Antrag schlichtweg abzuweisen (Aktenzeichen 2/Ws 80/80).
Im Fall des von einem Sonderkommando im Zuge einer Terroristenjagd erschossenen, völlig unbeteiligten Taxifahrers Günther Jendrian aus München wurden von den Ermittlungsbehörden ebenfalls die Angaben der Namen der beteiligten Polizeibeamten verweigert: Eine Namensoffenlegung - so die Begründung - "würde die Einsatzbereitschaft der Polizeibeamten in schwierigen Lagen, die eine sofortige Entscheidung über den Schußwaffengebrauch verlangen, beeinträchtigen". In erster Instanz wurde diese Begründung vom Verwaltungsgericht München bestätigt und ergänzt: Die Anonymität besonderer Polizeieinheiten wie der "Mobilen Einsatzkommandos" müsse im Interesse ihrer Funktionsfähigkeit gegenüber der Öffentlichkeit gewahrt bleiben. Das Straf-Ermittlungsverfahren gegen den Polizeischützen wurde bereits kurz nach dem Vorfall mit der Begründung "Notwehr" eingestellt.
Diese Argumentation der "Funktionstüchtigkeit der Polizei" findet sich immer wieder in Gerichtsurteilen, in denen sie zu einem zentralen vorrechtlichen Bezugspunkt der justiziellen Beurteilung von polizeilichen Todesschüssen gerät. So wurde etwa das äußerst milde Urteil des Landgerichts München gegen einen Polizeischützen, der sich für die Erschießung eines unbewaffneten 14jährigen Jungen in Gauting zu verantworten hatte, mit dem Argument begründet, die Entscheidung dürfe keinesfalls dazu führen, daß sich Polizeibeamte künftig bei vergleichbaren Einsätzen übertrieben zurückhielten.73 *
4. Diese Entwicklung einer unkontrollierten und unkontrollierbaren, teilweise geheimen Sonderpolizei findet in den gerichtlichen Verfahren ihre absichernde Entsprechung in der behördlichen Verweigerung oder Beschränkung von Aussagegenehmigungen für Polizeizeugen. Von dieser Möglichkeit wird amtlicherseits reger Gebrauch gemacht, sobald es um verfahrenswichtige polizeistrategische oder -taktische Angelegenheiten geht, die dann kurzerhand zu polizeiinternen Geheimnissen erklärt werden; ihre Preisgabe kann dann im Namen des "Staatswohls" verweigert werden.
Diese exekutiven Einflüsse und Steuerungsmöglichkeiten haben in den untersuchten Todesschuß-Fällen entscheidenden Einfluß auf die Beweiserhebungen und Sachverhaltsfeststellungen der befaßten Gerichte und halten so die Mechanik der (Vor-) Freisprüche in den einen und der (Vor-) Verurteilungen in den anderen Fällen am Laufen: Der Polizei - als am Schußwechsel beteiligter Partei sowie als später ermittelnden Behörde in einem - fällt die Definitionsmacht über die jeweilige Situation vor Ort zu, falls es, wie meist, keine neutralen Zeugen gibt.74 * Die Polizeiführungen bestimmen sozusagen in eigener Sache, ob etwa polizeiliche Todesschützen vor Gericht erscheinen, was Polizeizeugen aussagen dürfen und was nicht.
Die Staatsanwaltschaften haben sich nur äußerst selten als Korrektiv hierzu erwiesen. Ihre objektive Rolle im Verhältnis zur Polizei ist gerade ein Schlüssel zur Erklärung der vorgerichtlichen Ermittlungspraktiken. Die Polizei führt nach der Strafprozeßordnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft - als deren "Hilfsbeamte" sie dann tätig wird - auch die Ermittlungen in eigener Sache: Sie ist also Ermittlungsinstanz gegen sich selbst - eine in einem Rechtsstaat unerträgliche Situation. Der bekannte Korps-Geist im Polizeiapparat kann sich also voll entfalten. Und die funktionell dem "Staatswohl" dienenden Staatsanwälte tun sich traditionell schwer damit, gegen in Verdacht geratene "Staatsdiener" im Polizeidienst mit der gleichen Intensität zu ermitteln, wie sie das gegen Privatpersonen zu tun pflegen. Das Bekenntnis des Frankfurter Staatsanwalts Weiss-Bolland, das er vor Gerichtsreferendaren, also vor künftigen Staatsanwälten und Richtern, ablegte, ist hierfür symptomatisch:75 *©
"Diese wechselseitige Deckung von Polizeibeamten ist unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren einer Polizei, wie wir sie brauchen. Vor einiger Zeit war ... ein Überfall auf den Großmarkt ... Ich kann nicht verlangen und begrüßen, daß sich Polizeibeamte hier mannhaft mit der Maschinenpistole einsetzen, ohne dem gleichen Polizisten auch zuzugestehen, anderswo einmal über die Stränge zu schlagen... Weil das aber so ist, daß ich das dem Beamten einfach nicht verübeln kann, dann finde ich es auch aufrichtig, wenn Polizeibeamte sich durch ihre Aussagen auch wechselseitig decken. Sie müssen verstehen, daß die Kameradschaft, die hierin zum Ausdruck kommt, einfach notwendig ist, wenn wir nicht das Funktionieren von Verbänden wie der Polizei oder auch der Bundeswehr ... in Frage stellen wollen. Wo kämen wir denn hin, wenn ein Polizist sich nicht mehr auf diese Kameradschaft seiner Kollegen verlassen könnte, wenn er sich nicht mehr darauf verlassen könnte, daß sein Kamerad zu ihm hält und ihn notfalls auch deckt."
Der Manipulation von Gerichtsverfahren ist mit diesen exekutiven, vorjustiziell weitgehend gedeckten Einflußnahmen Tür und Tor geöffnet, soweit und solange sich die Gerichte diesen Einwirkungen und Kontroll-Beschränkungen unterwerfen, was viel zu häufig der Fall ist. Die Strafrichter, insbesondere jene in der politischen Justiz, haben die exekutive Position so stark verinnerlicht, daß sie bereit sind, der Polizei, aber auch den Geheimdiensten allzu vieles nachzusehen und beamteten Zeugen mehr zu glauben, als Privatpersonen.
Die parteiliche Polizeiversion über tödlich verlaufende Fahndungen triumphiert qua exekutivem Amtsbonus über die historische Wahrheit und wird so zur Basis des Gerichtsurteils und setzt sich unüberprüfbar als forensische "Wahrheit" in Parallel- und Nachfolge-Verfahren fort - voll zu Lasten der betroffenen Angeklagten und voll zu Gunsten des Staates, der sich auf diese Weise der Bevölkerung gegenüber zu entlasten weiß. Die Richter werden zu Rechtfertigungsgehilfen im Sinne der "Staatsräson", das Strafurteil zur nachträglichen politischen Legitimierung tödlich verlaufender Fahndungspraktiken.
Anmerkungen:
1 Dieser Text entstand im Rahmen des Forschungsprojektes "Terroristen & Richter" am Hamburger Institut für Sozialforschung (Stand: 1990). Da er in Gössners Buchpublikation "Das Anti-Terror-System - Politische Justiz im präventiven Sicherheitsstaat" (VSA-Hamburg 1991) aus Platzgründen keine Aufnahme gefunden hat, handelt es sich hier um eine Erstveröffentlichung (in gekürzter Fassung). Weitere Publikationen dieses Forschungsprojekts: Hannover, Terroristenprozesse - Erfahrungen und Erkenntnissse eines Strafverteidigers, VSA-Hamburg 1991; Overath, Drachenzähne - Gespräche, Dokumente und Recherchen aus der Wirklichkeit der Hochsicherheitsjustiz, VSA-Hamburg 1991.
2 S. dazu u.a.: Aust, Der Baader-Meinhof-Komplex, Hamburg 1986, s. 171 ff; Margot Overath, Von der Beweiserhebung zur Beweiserfindung, 6. Werner Hoppe.
3 Zu diesem Verfahren: Overath, Drachenzähne, Hamburg 1991; Parnass: Hoppe, ein Mörder? In: dies., Prozesse 1970 bis 1978, S. 229 ff.
4 Plädoyer vor dem Landgericht Hamburg vom 21.07.1972, S. 11 (Tonband-Abschrift)
5 Vgl. Gössner, Demonstrationsfreiheit unter Mordverdacht. Nach den Schüssen an der Startbahn-West (1987), in: ders., Widerstand gegen die Staatsgewalt, Hamburg 1988, S. 68 ff.
6 S. dazu: Sack, Die Reaktion von Gesellschaft, Politik und Staat auf die Studentenbewegung, in: Sack/Steinert, Protest und Reaktions 4/2, Opladen 1984, S. 107 ff (145 ff).
7 Scheerer, Die Ausgebürgerte Linke, in: Angriff auf das Herz des Staates (1. Band), Frankfurt 1988, S. 193 ff (329).
8 U. Meinhof in einem Interview mit Michele Ray nach einem Tonbandprotokoll, in: "Der Spiegel" vom 15.06.1970. Siehe dazu die Erwiderung der RAF in "Das Konzept Stadtguerilla", in: Schubert, Stadtguerilla, Westberlin 1971, S. 103 f ("Sie hat uns reingelegt ...").
9 Abgedruckt in: Schubert, Stadtguerilla, Westberlin 1971, S. 103 ff.
10 Scheerer, a.a.O. S. 297.
11 Zit. nach: Koch/Oltmanns, SOS - Freiheit in Deutschland, Hamburg 1978, S. 11.
12 Zit. nach: "stern" Nr. 27 vom 29.06.1978.
13 S. u.a. Bakker Schut u.a. (Hrg.), Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungsrecht, o.O. (Amsterdam) 1985; KB, "Jeder kann der nächste sein". Dokumentation der polizeilichen Todesschüsse und ihre Legitimation, Anti-faschistische Russell-Reihe 4, Hamburg 1978.
14 Quelle: dpa-Hintergrund-Archiv- und Informationsmaterial (dpa-Archiv/HG 2833 vom 10.07.1979), S. 14 ff. sowie "Amtlicher Ereigniskalender", der für 1979 und 1980 keine entsprechenden Todesfälle verzeichnet hat.
15 S. dazu: Bakker Schut, Stammheim, a.a.O., S. 305 ff, 363, 381.
16 Der Spiegel Nr. 20/1979, S. 97. S. dazu auch Heinrich Hannover, Kollaboration mit der Staatsgewalt als Kriterium der Freund-Feind-Unterscheidung, in: ders., Terroristenprozesse, Hamburg, S. 129 ff.
17 Zu beiden Fällen s. Margot Overath, Von der Beweiserhebung zu Beweiserfindung, 8. Klaus Jünschke, in: dies., Drachenzähne, a.a.O., S. 89 ff; Aust, a.a.O., S. 211, 225 f, 404.
18 S. dazu Heinrich Hannover, der Karl-Heinz Roth in dem sich anschließenden Mord-Verfahren verteidigte: Durchbrechung und Aufhebung der Feinderklärung, in: Hannover, Terroristenprozesse, a.a.O., S. 89 ff. Außerdem: Dethloff u.a. (Hrg.), Ein ganz gewöhnlicher Mordprozeß, Westberlin 1978.
19 In der Dokumentation "Jeder kann der nächste sein" sind allein für die Zeit zwischen 1971 und 1978 iinsgesamt 14 von Polizeikräften verursachte Todesfälle im Zusammenhang mit Terrorismus-Fahndungsaktionen aufgelistet (Dokumentation der polizeilichen Todesschüsse seit 1971 und ihre Legitimation, a.a.O., S. 197).a
20 Vgl. dazu Bakker Schut, Rambert u.a. (Hrg.), Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe ins Verteidigungsrecht, o.O. (Amsterdam) 1985, S. 5 ff.
21 Vgl. dazu: Böll u.a., Die Erschießung des Georg v. Rauch, Westberlin 1976; Aust, a.a.O., S. 205 ff.
22 Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Augsburg - Az. 110 Js 143/72; s. Bakker Schut u.a. (Hrg.), Todesschüsse ..., a.a.O., S. 6 f; s. auch Aust, a.a.O., s. 224 f. sowie Boll, Die Erschießung ..., a.a.O.
23 Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Augsburg - Az. 110 Jss 143/72 s. Bakker Schut u.a. (Hrg.), Todesschüsse ..., a.a.O., S. 6 f; s. auch Aust, a.a.O., S. 224 f.. sowie Böll, Die Erschießung ..., a.a.O.
24 So Bakker Schut u.a. (Hrg.), a.a.O., S. 7. Fall Stoll: Der kürzeste Prozeß: Der gezielte Todesschuß! hrg. von der Initiative gegen das Einheitliche Polizeigesetz, Ffm o.J., S. 4 ff.
25 S. dazu FAZ 09.09.1978; Braunschweiger Zeitung 08.09.1978; Frankfurter Rundschau 08.09.1978.
26 S. dazu: Der kürzeste Prozeß, Dokumentation, a.a.O., S. 17 ff.
27 Dazu: Cobler, Dunkelmänner, in: cilip 1/1978, S. 46 ff.
28 S. dazu ausführlich: Gössner/Herzog, Der Apparat, a.a.O., S. 178 ff, 192 ff (198 ff, 202 ff). KB, "Jeder kann der nächste sein", a.a.O.; s. 45 ff.
29 Urteil des Amtsgerichts Neuss v. 09.02.1981; Az. 2 b Ls/8 Js 287/80 - Erw. Sch.G. 150/80.
30 Kühnert, Wenn Polizisten töten, in: "Die Zeit" vom 20.02.1981.
31 Zit. nach KB, Jeder kann der nächste sein, a.a.O., S. 51.
32 S. dazu u.a. Gössner/Herzog, Der Apparat - Ermittlungen in Sachen Polizei, Köln 1984, S. 192 ff. m.w.N.; Mit Tödlicher Sicherheit. Zum Gladbecker/Bremer Geiseldrama und die Debatte um den gezielten Todesschuß, hrg. von "Bürger kontrollieren die Polizei", Bremen (Charlottenstr. 3) 1990.
33 Erwähnung finden sollen auch die folgenden beiden Punkte:
- Die neue Polizeibewaffnung mit dem größeren Kaliber 9 mm ( gegenüber den früheren 7,65 mm) und der entsprechenden Munition mit dem sog. Mann-Stop-Effekt, der unter bestimmten Bedingungen zur sofortigen Handlungsunfähigkeit der Getroffenen führt - häufig über den Tod;
- die neue automatische Sicherung der Waffen, die wesentlich unsicherer ist, als die klassische Sicherung bei den alten Polizeiwaffen (Problem der sich "unabsichtlich lösenden Schüsse").
34 S. dazu insbesondere Busch u.a., Die Polizei in der Bundesrepublik, Frankfurt/New York 1985.
35 S. dazu ausführlicher: Gössner/Herzog, Der Apparat, a.a.O., S. 233 ff.
36 S. dazu die tabellarischen Auflistungen in "Bürgerrechte & Polizei", die jährlich fortlaufend ergänzt werden und aus denen in der Regel ersichtlich ist, welchen Polizeibereichen die jeweiligen Todesschützen angehören. Zusammenfassung 1980 bis 1988, in: Mit tödlicher Sicherheit, a.a.O., S. 48 ff.
37 Zum ersten Mal dokumentiert in: Gössner/Herzog, Der Apparat, a.a.O., S. 195 ff.
38 S. auch Tophoven, GSG 9,. Kommando gegen Terrorismus, Koblenz/Bonn 1977, S. 44.
39 Tophoven, a.a.O., S. 49.
40 Hübner, Survival-Schieß-Technik, Civil Arms Verlag GmbH, Lichtenwald 1980.
41 Text in der Fassung vom 25. November 1977 mit offizieller Begründung und Anmerkungen in: Heise/Riegel, Musterentwurf eines einheitlichen Polizeigesetzes, Stuttgart u.a. 1978. S. auch Scholler/Broß, Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts in der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg/Karlsruhe 1978; kritisch dazu Ehrhardt/Kunze, Musterentwurf des Polizeirechtsstaates, Westberlin 1979; Funk/Werkentin, Nur kleine Kratzer am Rechtsstaat? In: Neue Politik 1/1979, S. 60 ff.
42 Art. 102 Grundgesetz: "Die Todesstrafe ist abgeschafft."
43 Vgl. zur Kritik: Gössner, in: Mit tödlicher Sicherheit, hrg. von Bürger kontrollieren die Polizei"!, Bremen 1990, S. 4 ff; ders., Schaarfschützen-Mentalität, in: Neue Kriminalpolitik 4/1989, S. 17.
44 Mertens, Zum polizeilichen Schußwaffengebrauch, in: Aktuelle Probleme des Polizeirechts, Westberlin 1977, S. 85.
45 Aus einer Broschüre der "Gewerkschaft der Polizei" GdP) zur "Eigensicherung".
46 LNF 371 Ausgabe 1981. "VS-NfD".
47 S. dazu u.a. Gössner/Herzog, Der Apparat, a.a.O., S. 214, 340 f. m.w.N.
48 1971: 3 (Buchert, Zum polizeilichen Schußwaffengebrauch, Lübeck 1975, Anhang 9) und 1972 - 1980: 62 (laut unveröffentlichter Zusammenstellung der Polizeiführungsakademie über sämtliche Länder- und Bundespolizeien, Stand Ende 1980, s. Weser-Kurier vom 03.12.1980), also insgesamt 65 Beamte. Von 1976 bis 1980 (5 Jahre) waren es es lediglich 17 (s. Die Polizei 7/1983, S. 229 sowie die Auskunft des BKA an den SPD-Bundestagsabgeordneten Thomas Schröer; abgedruckt in: Frankfurter Rundschau vom 25.03.1983.
49 Funk/Werkentin, in: Kritische Justiz 2/1976, S. 131.
50 Werkentin/Thies, Schneller und zielsicherer, in: Bürgerrechte & Polizei (cilip) 16/1983, S. 72 ff (S. 82, mit Tabelle S. 81).
51 Quelle: Die Polizei Nr. 9/1982.
Um die Hälfte geringer ist das Risiko allerdings in Großbritannien (England, Wales, Schottland). Dazu Werkentin/Thies: "Das heißt, daß gerade in dem Land, in dem weder die Ausbildung an Schußwaffen zum Regelfall der Polizeiausbildung gehört, noch Polizisten ständig Waffen mit sich führen, die Gefahr am geringsten ist, durch Straftäter getötet zu werden" (a.a.O., S. 82). Ihre Forderung, die sie aus dieser Tatsache ableiten: "Zumindest eine Teilentwaffnung der Polizei im Alltagsdienst ist geboten." (S. 84)
52 Riege, Kleine Polizeigeschichte, Lübeck 1966.
53 Lebenslänglich u.a.: Verena Becker, Angelika Speitel, Christine Kuby; 15 Jahre: Gert Schneider und Christoph Wackernagel.
54 Aust, Der Baader-Meinhof-Komplex, Hamburg 1986, S. 157 f.
55 Zit. nach "Die Welt" vom 23.02.1980.
56 Dazu Heinrich Hannover, der Astrid Proll verteidigt hat, in: Terroristenprozesse, Kapitel "Durchbrechung und Aufhebung der Feinderklärung", S. 89 ff.
57 Alle nachfolgenden Zeitungsartikel vom 12. Februar 1971.
58 S. dazu Dieter Herold, Schüsse aus der falschen Richtung, in "stern" Nr. 27/1978), S. 82 - 84.
59 Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth vom 15.06.1979 - Az.: 340 JS 18/79. Darin heißt es: "Der Schußwaffengebrauch der Polizeibeamten Nr. 24 und 26 ... war ... gerechtfertigt, da die Beamten in Notwehr gehandelt haben. Dieses Notwehrrecht steht jedem Staatsbürgger zu."
Die Staatsanwaltschaft bezieht sich dabei auf die Tatsache, daß Elisabeth von Dyck bewaffnet war, obgleich sie von der Schußwaffe keinen Gebrauch machte.
60 Auszugsweise dokumentiert in Bakker Schut u.a., Todesschüsse ..., a.a.O., S. 8 ff. S. zu diesem Fall auch: Der kürzeste Prozeß: Der gezielte Todesschuß! Dokumentation, a.a.O., S. 11 ff.
61 Zit. nach "Die Welt" vom 28.06.1972.
62 Buchert, Zum polizeilichen Schußwaffengebrauch, Lübeck 1975, S. 26, Anm. 105.
63 BGH-Urteil vom 20.03.1975, in: NJW 1975, S. 1231 f.
64 Walter/Werkentin, Die justizielle Kontrolle polizeilicher Todesschüsse, in: Bürgerrechte & Polizei 26/1987, S. 5 ff.
65 Vgl. 24 Bundesbeamtenrechts-Rahmengesetz sowie die Parallel-Regelungen in den Landes-Beamtengesetzen, die bei einer Freiheitsstrafe (wegen einer vorsätzlichen Tat) von einem Jahr oder mehr, das Beamtenverhältnis für beendet erklären. Allerdings wurde im genannten Untersuchungszeitraum nicht ein einziger Todesschütze wegen "vorsätzlicher", sondern ausschließlich wegen "fahrlässig begangener" Straftaten verurteilt. Doch selbst bei Vorsatz finden nach herrschender Meinung und Rechtsprechung die genannten Regelungen keine Anwendung, wenn die Verurteilung zur Bewährung ausgesprochen wird, was bei polizeilichen Todesschüssen die Regel ist (bis zu 2 Jahren).
66 S. dazu: Gössner/Herzog, Der Apparat, a.a.O., S. 203 ff., dies., Staatsgewalten unter sich. Wer kontrolliert die Polizei, Bremen 1983 ("Bürger kontrollieren die Polizei", Charlottenstr. 3, Bremen), S. 17 ff
67 Walter/Werkentin, a.a. O., in: Bürgerrechte & Polizei 26/1987, S. 5 ff (22).
68 Urteilsbegründung der 53. Strafkammer (Schwurgericht) des Landgerichts Berlin im Fall des 18jährigen Andreas Piper, der am 21.11.1982 in Berlin bei Dunkelheit als mutmaßlicher, unbewaffneter Einbrecher auf der Flucht "ungezielt" von einem Funkstreifenbeamten erschossen worden war. Dieses erstinstanzliche Ureil lautete - eine absolute Ausnahme - wegen "bedingt vorsätzlichen Totschlags" auf 2 Jahre und 6 Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung (Az.: /553/ 1 Kap Ks 40/83 /24/83/ - zit. nach Walter/Werkentin, a.a.O., S. 21).
In 2. Instanz wurde der angeklagte Polizeibeamte - nun wieder gewohnheitsmäßig - nur wegen "fahrlässiger Tötung" zu lediglich einem Jahr mit Bewährung verurteilt.
69 Eine entsprechende "Polizeibetreuung" ist in nahezu allen von Polizeibeamten verursachten Todesschußfällen feststellbar, z.B. auch in den Fällen Petra Schelm und Manfred Perder - mit entsprechend gravierenden Folgen für die jeweiligen Verfahren und Entscheidungen.
70 Ziel und Mittel der polizeilichen Zeugenbetreuung sind allgemein gefaßt in polizeiinternen "Merkblättern" festgelegt.
71 Zu diesem Komplex: Maeffert, Polizeiliche Zeugenbetreuung, Frankfurt 1980.
72 Dazu u.a.: Der kürzeste Prozeß: Der gezielte Todesschuß! Dokumentation, a.a.O., S.. 17 ff.
73 Laut FR v. 02.07.1983; in die schriftliche Urteilsbegründung wurde das Argument nicht aufgenommen. Der Polizeischütze kam mit 6 Monaten Freiheitsstrafe mit Bewährung und 3.500 DM Geldstrafe davon ("Fahrlässige Tötung"). Der erschossene Junge hatte in der Nacht des 21.03.1983 in Gauting bei München lediglich eine Fensterscheibe in einem Jugendzentrum eingeschlagen, um darin zu nächtigen. Dabei wurde er von dem Zivil-Polizisten als mutmaßlicher Einbrecher mit drei Schüssen getötet.
74 S. dazu: Gössner/Herzog, Im Schatten des Rechts - Methoden einer neuen Geheim-Polizei, Köln 1984, S. 259 ff sowie dies., Staatsgewalten unter sich, a.a.O., S. 25.
75 Uns liegt die Eidesstattliche Versicherung (vom 18. Januar 1982) eines ehemaligen Gerichtsreferendars, des heutigen Rechtsanwalt Helmut B. vor, nach welcher der erwähnte Staatsanwalt im Jahre 1975 während einer Arbeitsgemeinschaft von Gerichtsreferendaren am Landgericht Hanau diese Ausführungen gemacht hat.
