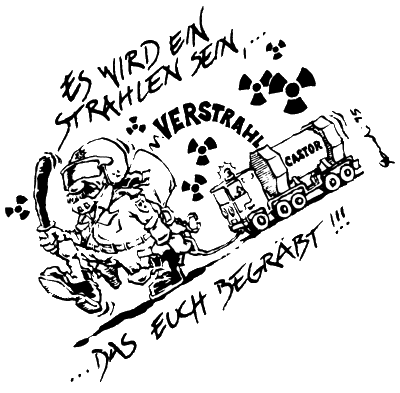Zur Geschichte der Autonomen in der alten West-BRD ein Abriß
aus Feuer & Flamme - ID-Verlag
A Taste of Revolution: 1968
»Die materiellen Voraussetzungen für die Machbarkeit unserer Geschichte sind gegeben. Die Entwicklungen der Produktivkräfte haben einen Prozeßpunkt erreicht, wo die Abschaffung von Hunger, Krieg und Herrschaft materiell möglich geworden ist. Alles hängt vom bewußten Willen der Menschen ab, ihre schon immer von ihnen gemachte Geschichte endlich bewußt zu machen, sie zu kontrollieren, sie zu unterwerfen ...«
Rudi Dutschke im Juni 1967
 Das Jahr 1968 markiert sowohl für die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte als auch im internationalen Maßstab einen wichtigen Einschnitt. Für die BRD zeichnete sich diese Zäsur bereits in den Jahren 66/67 durch den ersten massiven ökonomischen Kriseneinbruch in das sogenannte »Wirtschaftswunder« ab. Auf der parlamentarischen Ebene kam es zu einer großen Regierungskoalition zwischen SPD und CDU. Gemeinsam bereiteten beide Parteien eine »Notstandsverfassung« vor, die im »Krisenfall« alle bürgerlichen Freiheitsrechte zugunsten einer parlamentarisch nicht mehr kontrollierten Notstandsregierung suspendieren sollte. Sowohl in der linksliberalen Öffentlichkeit als auch in Gewerkschafts- und Studentenkreisen wurde die Tendenz zu einem »autoritären Staat« gesehen, einer Demokratie ohne Demokraten und ohne Opposition.
Das Jahr 1968 markiert sowohl für die bundesdeutsche Nachkriegsgeschichte als auch im internationalen Maßstab einen wichtigen Einschnitt. Für die BRD zeichnete sich diese Zäsur bereits in den Jahren 66/67 durch den ersten massiven ökonomischen Kriseneinbruch in das sogenannte »Wirtschaftswunder« ab. Auf der parlamentarischen Ebene kam es zu einer großen Regierungskoalition zwischen SPD und CDU. Gemeinsam bereiteten beide Parteien eine »Notstandsverfassung« vor, die im »Krisenfall« alle bürgerlichen Freiheitsrechte zugunsten einer parlamentarisch nicht mehr kontrollierten Notstandsregierung suspendieren sollte. Sowohl in der linksliberalen Öffentlichkeit als auch in Gewerkschafts- und Studentenkreisen wurde die Tendenz zu einem »autoritären Staat« gesehen, einer Demokratie ohne Demokraten und ohne Opposition.
Auf internationaler Ebene war das ganze Jahr 1968 durch bedeutsame politische Entwicklungen und eine Vielzahl von Aktionen der Studentenbewegung in den USA, Italien, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Mexico, Japan u.a. gekennzeichnet. Die im April 1968 einsetzende TET-Offensive der vietnamesischen Befreiungsbewegung FNL gegen die Besetzung ihres Landes durch die US-Imperialisten bricht weltweit den Glauben an die unschlagbare politische und militärische Führungskraft der USA als Weltmacht. Im Frühjahr brachte der »Pariser Mai« mit seinen Barrikaden und Kämpfen in der Pariser Innenstadt das bürgerlich-kapitalistische Regierungssystem in Frankreich an den Rand des Sturzes. Zu jenem Zeitpunkt weckte der Beginn des »Prager Frühlings« in der CSSR weltweit bei vielen Menschen die Hoffnung auf einen vom Stalinismus befreiten »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«.
In dieser historischen Phase konnte sich die westdeutsche Studentenrevolte und die Außerparlamentarische Opposition (APO) als Teil einer internationalen revolutionären Bewegung begreifen.
Wie kam es zur Studentenrevolte?
In den 60er Jahren war innerhalb der überwiegend politisch passiven und konservativen Studentenschaft der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) aktiv. Er war im Jahre 1961 wegen seiner Weigerung, den Anpassungskurs der SPD an die bürgerlichen Herrschaftsverhältnisse mitzuvollziehen, von der Partei ausgeschlossen worden. In der Folge wurde der Verband zu einem Zentrum der durch die SPD-Politik heimatlos gewordenen linken Intellektuellen in der BRD und West-Berlin.
Schwerpunkte der Arbeit des SDS bis Mitte der 60er Jahre waren u.a. die marxistische Theoriebildung, die Demokratisierung der Hochschulen sowie die Internationalismusarbeit. War der Verband Ende der 50er Jahre noch stark in der Algeriensolidarität engagiert, so verschob sich dieses Engagement nach der Befreiung Algeriens vom französischen Kolonialregime immer mehr zu einer Solidaritätsarbeit mit anderen Befreiungskämpfen. In diesem Zusammenhang spielt die Vietnam-Solidarität eine zunehmend wichtigere Rolle. Insbesondere in West-Berlin sammelte der SDS zu Beginn der 60er Jahre in einer Reihe von Internationalismusaktionen erste praktische Erfahrungen mit einem offensiven Auftreten in der Öffentlichkeit. Dabei wurden neue Demonstrationstechniken entwickelt, die das Ritual der eher als »geordnete Trauermärsche« stattfindenden Demonstrationen aus der Adenauer-Zeit durchbrachen und die den Ablauf von Demos zum Kampf- und Erlebnisraum für die TeilnehmerInnen werden ließen. Rudi Dutschke erklärte, daß es das Ziel von Massenaktionen sein müsse, diese zum Zwecke der kollektiven und individuellen Selbstveränderung in die Illegalität zu überführen. Die Studenten lieferten sich mit den darauf nicht eingestellten Bullen erste kleinere Scharmützel und wurden daraufhin das bevorzugte Haßobjekt der Springerpresse.
In West-Berlin spitzte sich die Entwicklung zunächst in den Ereignissen vom 2. Juni 1967 zu: Für diesen Tag war der Besuch des persischen Diktators Schah Reza Pahlevi in der Stadt mit einem Empfang beim Senat vorgesehen. Im Rahmen der vom SDS betriebenen Internationalismusarbeit war es nur mehr als konsequent, gegen die Hofierung dieses Menschenschlächters durch deutsche Regierungsbehörden zu protestieren. Erstmals in der Geschichte der BRD wurde von den Staatsschutzbehörden mit über 10.000 eingesetzten Bullen eine Art »Notstandsübung« zum Schutz des Staatsgastes organisiert. Dabei brachten schon vor dem 2. Juni mehrere polizeiliche Vollsperrungen von Autobahnen auf der Fahrtroute des Schahs den Verkehr teilweise zum Erliegen.
Am 2. Juni 1967 demonstrierten in West-Berlin relativ friedlich 2.000 Menschen vor der Deutschen Oper. Die meisten von ihnen waren Studenten und Schüler, die durch vorherige Informationsveranstaltungen des SDS an der Freien Universität über die Realität der Diktatur mobilisiert worden waren. Sie empfingen den Staatsgast mit »Mörder«-Rufen, Rauchkerzen und Eiern. Dafür wurden sie zunächst von mit Stahlruten ausgerüsteten Geheimdienstagenten des Schahs angegriffen, wenig später kam es durch einen brutalen Bulleneinsatz zu einer Auflösung der Demonstration. Dabei wurde der Student Benno Ohnesorg hinterrücks von einem Bullen mit einem Kopfschuß ermordet. Der Senat verhängte danach aufgrund gezielter Falschmeldungen angeblich sollte ein Polizist von Demonstranten getötet worden sein ein vollständiges Demonstrationsverbot über die ganze Stadt. Die von staatlichen Stellen und der Springerpresse betriebene Hetze und Pogromstimmung gegen die oppositionellen Studenten steigerte sich in einem bislang nicht gekannten Ausmaß.
In einer enormen Anstrengung gelang es den Studenten jedoch, durch eigene Recherchen und die Einsetzung eines »Ermittlungsausschusses« den genauen Sachverhalt des Bulleneinsatzes und der Ermordung von Benno Ohnesorg aufzuklären. Es bildeten sich räteartige Strukturen, die für einige Tage mit massenhaften Aufklärungsaktionen in der Stadt eine Gegenöffentlichkeit zu den staatlichen Ausgrenzungs- und Repressionsstrategien herstellen konnten. Eine Woche nach der Ermordung Benno Ohnesorgs stellte Rudi Dutschke auf einer Veranstaltung in Hannover zu diesem Moment von spontaner Selbstorganisierung fest:
»Und es zeigte sich bei uns in West-Berlin, daß die Phase der direkten Auseinandersetzung mit der etablierten Ordnung auch die festen Organisationen der Studentenschaft ... unterläuft. Daß allein die praktische, kritische Entfaltung der bewußtesten Teile der Studentenschaft durch entstehende Aktionszentren eine politische Kontinuität der Auseinandersetzung unter größter Beteiligung der Studentenschaft ermöglicht, was unter SDS-Flagge unmöglich ist, ... darum Aktionszentren zur Kontinuität der politischen Arbeit an der Universität, wir sind jetzt schon über eine Woche tätig, das ist der längste Zeitraum wirklich massenhafter, politischer Kontinuität, die wir je in West-Berlin gehabt haben, wir haben die Hoffnung, daß diese räteartigen Gebilde an allen westdeutschen Universitäten in den nächsten Tagen gegründet werden, denn die rationale Bewältigung der Konfliktsituation in der Gesellschaft impliziert konstitutiv die Aktion, wird doch Aufklärung ohne Aktion nur schnell zum Konsum, wie Aktion ohne rationale Bewältigung der Problematik in Irrationalität umschlägt.«
Insbesondere die Erfahrungen mit der Springerpresse führten innerhalb des SDS zu ersten Überlegungen von Gegenaktionen und mündeten zunächst in Vorbereitungen für eine Kampagne gegen den Pressekonzern, die unter der Forderung »Enteignet Springer« zu Beginn des Jahres 1968 in Angriff genommen werden sollte.
Studentenrevolte und APO
Bis zum Sommer 1967 war die Studentenbewegung hauptsächlich auf die Ereignisse in West-Berlin beschränkt. Eine breite Ausweitung der Aktionen auf das Bundesgebiet setzte erst im Laufe des Jahres 1968 ein: In diesem Jahr erfuhr die Studentenbewegung in einem kurzen Zeitabschnitt sowohl ihre politischen Höhepunkte, bei denen sie sich zur APO ausweitete, als auch ihren Niedergang und Zerfall.
 Im Februar fand im Audimax der TU Berlin der internationale Vietnam-Kongreß mit mehreren tausend TeilnehmerInnen statt. Er faßte jahrelange Bemühungen des SDS in der Internationalismus- und Solidaritätsarbeit zu Vietnam zusammen. Diese Arbeit bestand in einer kontinuierlichen Gegeninformation zu der von bundesdeutschen Medien verbreiteten Propaganda über die Realität des Befreiungskampfes des vietnamesischen Volkes gegen die US-Imperialisten. Auf dem Vietnamkongreß verknüpfte sich diese Solidaritätsarbeit mit dem Anspruch, sich als Teil einer weltweiten revolutionären Bewegung zu begreifen, die den antiimperialistischen Befreiungskampf der »Dritten Welt« mit einem Kampf um Sozialismus in der Metropole verband. Am 17.2. wird in einer gemeinsam verfaßten Schlußresolution festgestellt: »Die Opposition steht vor dem Übergang vom Protest zum politischen Widerstand ...« Als konkreter Schritt wurde u.a. eine Kampagne zur materiellen Unterstützung des Vietcong vorgeschlagen, die zugleich mit einer Kampagne zur Wehrkraftzersetzung innerhalb der US-Armee verknüpft werden sollte. Als längerfristige Perspektive wurde die Parole »Zerschlagt die NATO« proklamiert.
Im Februar fand im Audimax der TU Berlin der internationale Vietnam-Kongreß mit mehreren tausend TeilnehmerInnen statt. Er faßte jahrelange Bemühungen des SDS in der Internationalismus- und Solidaritätsarbeit zu Vietnam zusammen. Diese Arbeit bestand in einer kontinuierlichen Gegeninformation zu der von bundesdeutschen Medien verbreiteten Propaganda über die Realität des Befreiungskampfes des vietnamesischen Volkes gegen die US-Imperialisten. Auf dem Vietnamkongreß verknüpfte sich diese Solidaritätsarbeit mit dem Anspruch, sich als Teil einer weltweiten revolutionären Bewegung zu begreifen, die den antiimperialistischen Befreiungskampf der »Dritten Welt« mit einem Kampf um Sozialismus in der Metropole verband. Am 17.2. wird in einer gemeinsam verfaßten Schlußresolution festgestellt: »Die Opposition steht vor dem Übergang vom Protest zum politischen Widerstand ...« Als konkreter Schritt wurde u.a. eine Kampagne zur materiellen Unterstützung des Vietcong vorgeschlagen, die zugleich mit einer Kampagne zur Wehrkraftzersetzung innerhalb der US-Armee verknüpft werden sollte. Als längerfristige Perspektive wurde die Parole »Zerschlagt die NATO« proklamiert.
Im Anschluß an den Kongreß fand eine internationalistische Demonstration von weit über 10.000 TeilnehmerInnen durch West-Berlin statt. Erstmals nach der Teilung waren die Straßen der West-Stadt wieder von einem Meer roter Fahnen eingenommen. Viele DemonstrantInnen liefen fest eingehakt in Ketten, womit eine Demonstrationstechnik übernommen wurde, die unter anderem von der linksradikalen französischen Gruppierung »Gauche Proletarienne« praktiziert worden war.
Am 11. April kam es zu einem Mordanschlag auf Rudi Dutschke, der zuvor durch die monatelange Berichterstattung der Springerpresse systematisch vorbereitet worden war. Über die Osterfeiertage fanden in der BRD und West-Berlin bei Blockaden der Springer-Produktionsstätten die heftigsten Straßenschlachten seit Bestehen der Bundesrepublik statt. In West-Berlin wurden von 2.000 DemonstrantInnen bei dem Versuch, das Springerhochhaus zu stürmen, die Fahrzeughalle sowie mehrere Auslieferungsfahrzeuge in Brand gesteckt. An den Demonstrationen, Blockaden und Straßenschlachten im Bundesgebiet beteiligten sich 60.000 Menschen. Die eingesetzten 21.000 Polizisten verhafteten über 1.000 DemonstrantInnen. Peter Brückner schreibt über die Bedeutung dieser Aktionen:
»Das 'Springer'-Frühjahr markiert ... symbolisch einen Wendepunkt für anti-imperialistische und antikapitalistische Bewegungen an Hochschule und Universität. Wenn die Massenpresse ihre gesellschaftliche Funktion, Massenloyalitäten herzustellen und zu sichern, nicht mehr erfüllen kann, wenn sie ... bestehende Verhältnisse nicht vor dem Entstehen revoltierender Kritik bewahrt, sondern ihrerseits vorm Zugriff der Revolte polizeilich geschützt werden muß, wie nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, erreicht die Auseinandersetzung mit dem Establishment eine neue Qualität.«
Das Ausmaß der in den Massenaktionen sichtbar gewordenen Beteiligung vieler Menschen eröffnet innerhalb der Bewegung eine Diskussion über das Verhältnis von Protest und Widerstand. In der Mai-Ausgabe der Konkret schrieb Ulrike Meinhof:
»Protest ist, wenn ich sage, das und das paßt mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, daß das, was mir nicht paßt, nicht länger geschieht .... Die Grenze zwischen verbalem Protest und physischem Widerstand ist bei den Protesten gegen den Anschlag auf Rudi Dutschke in den Osterfeiertagen erstmals massenhaft ... überschritten worden.«
Durch die Teilnahme von vielen Schülern und jugendlichen Arbeitern an den Springer-Aktionen gelang es der Studentenbewegung erstmals, ihre politische Resonanz in andere Bereiche der Gesellschaft auszuweiten. Das drückte sich auch in den Veranstaltungen und Demonstrationen am 1. Mai 1968 aus: In der ganzen BRD veranstalteten Gruppen der APO neben den offiziellen Mai-Kundgebungen des DGB eigenständige Kundgebungen. In West-Berlin wurden 40.000 Menschen für die APO-Manifestation mobilisiert. Allerdings brach diese politische Ausweitung, die mit einer Orientierung der APO auf die Arbeiterklasse und Gewerkschaften verknüpft war, beim Kampf gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze in sich zusammen. Zwar gelang es am 11. Mai noch einmal, mit dem aus Gewerkschaftlern, Publizisten, Studentenvertretern und einzelnen SPD-Mitgliedern zusammengesetzten Kuratorium »Notstand und Demokratie« 60.000 Menschen zu einem Sternmarsch nach Bonn zu mobilisieren; die danach von Studenten an die Adresse des DGB erhobene Forderung nach einer Ausrufung des Generalstreiks wurde jedoch nicht aufgenommen. Es kam lediglich in ein paar Regionen zu Warnstreiks.
Trotz einer enormen Agitation der Studentenbewegung vor Betrieben, die durch die gleichzeitig stattfindenden Ereignisse in Frankreich noch verstärkt wurde, stellte sich zwischen ihr und der Arbeiterklasse kein nennenswerter Kontakt her. Der revolutionäre Impuls der westdeutschen APO konnte sich im Unterschied zu Frankreich oder Italien an keinerlei revolutionären Organisationskernen der Arbeiterbewegung orientieren. Die Mobilisierungsschwierigkeiten innerhalb der bundesdeutschen Arbeiterklasse führten in den Folgejahren zu den verschiedensten strategischen Orientierungen von Gruppen der Neuen Linken.
Die Politik des SDS
Die wichtigste Organisation innerhalb der Studentenbewegung war der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS). Er eröffnete als Organisation von radikalen Intellektuellen die Möglichkeit zur Diskussion marxistischer Theorie in einer Zeit weitgehender gesellschaftspolitischer Stagnation. Von 1965-69 verliefen die Auseinandersetzungen innerhalb des SDS zwischen den Agitations- und Aktionszentren Frankfurt/Berlin gegenüber den SDS-»Provinzen« Hamburg, Kiel, Köln, Marburg, Heidelberg, Tübingen und München. Politisch zentral war zunächst noch der Konflikt zwischen den »Traditionalisten« und den »Antiautoritären«.
Unter dem Begriff der »Traditionalisten« lassen sich alle diejenigen Bestrebungen fassen, die auf den orthodox-kommunistischen Flügel der Arbeiterbewegung orientiert waren. Als im September 1968 die DKP gegründet wurde, gingen die SDS-Gruppen Marburg und Köln fast geschlossen in dieser Organisation auf.
Die Fraktion der »Antiautoritären« lehnte sich demgegenüber theoretisch stark an Arbeiten der Kritischen Theorie, des Linkskommunismus sowie an einer Reaktualisierung von Momenten der anarchistischen Kritik am Marxismus an. Doch nicht nur der Bezug zu den in der deutschen Arbeiterbewegung vergessenen und verdrängten Theorieansätzen machte die Qualität des »Antiautoritarismus« aus: gleichzeitig mit der Aufnahme neuer Theorieansätze begründete er ein neues Theorie-Praxis-Verhältnis. Die Theoriebildung war wesentlich von den unmittelbaren Auseinandersetzungen auf Kongressen und Teach-Ins und über die im Kontext von konkreten Aktionen zu fällenden Entscheidungen bestimmt. Theorien wurden dabei weniger als dogmatische Lehrgebäude referiert, sondern mehr als Steinbrüche benutzt, die im Hinblick auf die konkrete Situation improvisiert und in einer politischen Praxis aufgehoben wurden. In dieser Form der Theorieanwendung ging es darum, eine Spannung zwischen der unmittelbaren Realität der konkreten Aktion zu den verallgemeinerbaren Dimensionen ihrer politischen Reichweite herzustellen. Die Theorieversatzstücke der »Antiautoritären« wurden so in einem bestimmten historischen Moment zu einer vorwärtstreibenden Provokation gegen die bestehenden Verhältnisse.
Die in der Öffentlichkeit bekanntesten Sprecher dieser Richtung im SDS waren Rudi Dutschke (SDS Berlin) und Hans-Jürgen Krahl (SDS Frankfurt). Rudi Dutschkes Auffassungen waren stark von den Ideen der »Situationistischen Internationale« beeinflußt worden. Mitte der 60er Jahre trat er als Mitglied der »Subversiven Aktion« in den SDS ein. Krahls Positionen waren wesentlich von den Auseinandersetzungen mit den am Frankfurter Institut für Sozialforschung lehrenden professoralen Vertretern der Kritischen Theorie Horkheimer und Adorno geprägt.
Ein besonders populärer Ausdruck des antiautoritären Denkens und Handelns drückte sich in den Aktionen und Happenings der »Kommune 1« aus. Sie praktizierte in der Öffentlichkeit provokante Formen ihres Zusammenlebens, bezeichnete FU-Professoren als »Fachidioten«, plante ein Attentat mit Pudding auf den US-Vizepräsidenten, machte Farbeieraktionen, verteilte Flugblätter mit der Aufforderung, Warenhäuser niederzubrennen und inszenierte »Moabiter Seifenopern«, die die Justizbehörde der Lächerlichkeit preisgaben. Die Politik der »Kommune 1« war ein permanenter Aufruf zum Handeln, nicht nur als ein Mittel zum Kampf gegen den Staat und die Gesellschaft, sondern auch zur Selbstveränderung. Ihre aufrüttelnden und provokanten Aktions- und Happeningstrategien führten schließlich im Mai 1967 zum Ausschluß aus dem West-Berliner SDS. In der Begründung wurden ihr von der Fraktion der West-Berliner Variante der »Traditionalisten« »voll frostiger Kälte von Objektivität und Politik voluntaristische Praktiken, Realitätsflucht, falsche Unmittelbarkeit« vorgeworfen (Mosler).
Auf der politischen Ebene konnten sich allerdings die antiautoritären Organisationsvorstellungen von Dutschke und Krahl auf der 22. Delegiertenkonferenz des SDS im September 1967 in Frankfurt gegen die Vorstellungen der »Traditionalisten« durchsetzen. In ihrem Referat stellen sie fest:
»Wir wissen sehr genau, daß es viele Genossinnen und Genossen im Verband gibt, die nicht mehr bereit sind, abstrakten Sozialismus, der nichts mit der eigenen Lebenstätigkeit zu tun hat, als politische Haltung zu akzeptieren ... Das Sich-Verweigern in den eigenen Institutionenmilieus erfordert Guerilla-Mentalität, sollen nicht Integration und Zynismus die nächste Station sein.«
Das antiautoritäre Denken, das auf das »Hier und Jetzt« insistiert und sich auf die »Große Verweigerung« von Marcuse bezieht, dominierte die nach dem September 1967 folgenden Aktionen der Studentenbewegung und der APO. Daraus ließen sich jedoch nur schwer Organisierungsvorstellungen ableiten. Die Unschärfen des antiautoritären Denkens liegen in den Ursprüngen der Studentenrevolte selbst begründet. Gerade das Fehlen von politischen Eindeutigkeiten machte eine der zentralen Erfahrungen dieser Zeit aus. Übrig blieb ein schwer fixierbarer, in jener Zeit ungeheuer mobilisierender Emanzipationsgedanke, der die Leute auf die Straßen und Barrikaden trieb.
In den Aktionen gegen Springer, zum 1. Mai 1968 und im Kampf gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze wurden die Grenzen der Mobilisierungsfähigkeit der APO sichtbar. Dabei zersetzten diese Massenaktionen die organisatorische Basis des SDS. Der Verband war nicht mehr in der Lage, in diesen Prozessen eine eigenständige Orientierung und Strategie zu formulieren.
Als Anfang November gegen den Rechtsanwalt Mahler wegen seiner Beteiligung an der Springer-Blockade ein Ehrengerichtsverfahren vor dem West-Berliner Landgericht eingeleitet werde, bereitete die APO eine militante Straßenschlacht vor. Die militärische Niederlage der Polizei in der »Schlacht am Tegeler Weg« war für viele der 1.000 DemonstrationsteilnehmerInnen eine späte Rache für die in den Jahren zuvor von den Bullen erlittenen Demütigungen. Die militante Auseinandersetzung mit der Staatsmacht konnte allerdings die offene Frage nach Perspektiven nicht klären.
Der Zerfall des SDS
Auf der im November 1968 stattfindenden Delegiertenkonferenz des SDS in Hannover ließ die zunehmende ideologische Verfestigung der einzelnen Fraktionen innerhalb des »antiautoritären« Lagers keine Verständigung mehr zu. In den Zentren der APO, Frankfurt und West-Berlin, wurde insbesondere von der zweiten Reihe des SDS-Apparates auf die Organisationsfrage gedrängt. In den Beiträgen aus den SDS-Gruppen West-Berlin und Heidelberg waren im Keim schon die späteren maoistisch orientierten ML-Parteien KPD/AO (Kommunistische Partei Deutschlands Aufbauorganisation) und der KBW (Kommunistischer Bund Westdeutschlands) erkennbar. Zwar wurden diese Konzeptionen von vielen »Antiautoritären« heftig kritisiert »Der SDS definiert sich nicht aus der Geschichte der kommunistischen Arbeiterparteien!« (Krahl) , der Zerfallsprozeß der Organisation konnte jedoch auch von ihnen nicht aufgehalten werden. Die ML-Konzeptionen gewannen unter dem Eindruck der streikenden Arbeiter im September 1969 für viele studentische Aktivisten eine große Anziehungskraft. Sie schienen am erfolgversprechendsten zu sein, um eine sozialistische Transformation der BRD zu erreichen. In West-Berlin zerfiel die Bewegung in rasender Geschwindigkeit. Bereits Mitte 1968 wurden von der APO in den verschiedensten Bereichen (Uni, Schulen, Stadtteile und Fabriken) Basiskomitees als Versuch gegründet, ein militantes Bündnis zwischen der Studentenbewegung und der Arbeiterklasse herzustellen. Dieser Versuch scheiterte jedoch in der Anti-Notstandskampagne. Zwar konnten sich ein paar Basisgruppen im Produktionsbereich mit einer relativ verbindlichen Arbeit konsolidieren, die meisten studentischen Aktivisten schreckten jedoch vor einer »mühseligen Kleinarbeit« in den Betrieben zurück. Diese Krise bewirkte schließlich eine Entfremdung zwischen betrieblich orientierten und Basisgruppen an der Universität, die im Ergebnis auch zu den verschiedenen Fraktionierungen und Kaderansätzen der APO führten. Ein fraktionsübergreifender Versuch zur Verständigung mit Hilfe einer Konferenz gegen Ende des Jahres 1969 mißlang.
Nachdem die traditionalistische Richtung des SDS in die neugegründete DKP aufgegangen war, kam es innerhalb des noch verbleibenden antiautoritären Lagers zu verschiedenen Fraktionierungen. Ein Teil gründete mit maoistisch-stalinistischen Theoremen angereicherte autoritär-dogmatische Parteiorganisationen. Demgegenüber verstand sich der andere Teil des antiautoritären Lagers als »undogmatisch« und verzichtete dabei auf zentralistische Organisationsformen. Quer zu diesen Fraktionierungsprozessen verlief die Abspaltung und eigenständige Organisierung eines Teils der SDS-Frauen, die damit den Grundstein für das Entstehen der autonomen Frauenbewegung legten.
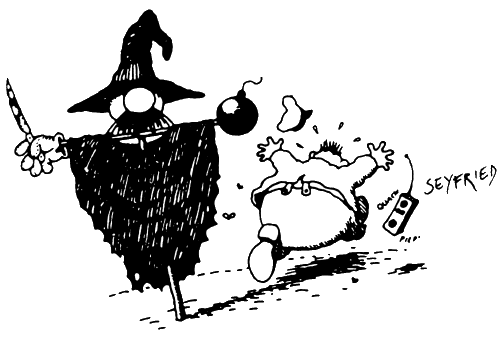 Die militanten Basisströmungen
Die militanten Basisströmungen
Neben den konkurrierenden SDS-Fraktionen waren immer auch die militanten Basisströmungen an der Revolte hauptsächlich auf der Straße beteiligt. Sie setzten sich aus unorganisierten StudentInnen, Lehrlingen, SchülerInnen und JungarbeiterInnen zusammen.
»Diese Basisströmungen hatten viele Namen und operierten an vielen Orten: umherschweifende Haschrebellen in West-Berlin, Black-Panther-Komitees im Raum Frankfurt, Weiße Rose und Deserteurgruppen im Raum Hamburg und Hannover, Sozialistisches Patientenkollektiv in Heidelberg. Genauso vielfältig waren ihre Aktionen: Transporte und Papierbeschaffung für desertierte GIs und Bundeswehrsoldaten, Sprengstoffanschläge auf Einrichtungen und Depots der Besatzungsmächte, Aktionen gegen Erziehungsheime und Knäste, Angriffe auf die psychiatrischen Krankenhäuser, Zerstörung von Rüstungsproduktion für die portugiesische Kolonialmacht, Ausräumen von Generalkonsulaten terroristischer Regimes, Klauen und Veröffentlichen von Geheimdokumenten, Lahmlegen des Fahndungsapparates der Polizei, Geldbeschaffung für Alternativprojekte« (K.H. Roth).
Die Basisströmungen drückten innerhalb der APO die vorhandene Subversionsmentalität aus. Mit der Revolte war auch der »Fleiß« und die »deutsche Arbeitsmoral« angegriffen worden, und viele GenossInnen schmissen mit ihrem Job zugleich auch die lebenslange Perspektive, sich immer unterordnen zu müssen. Die mehr oder weniger offen propagierte und praktizierte Leistungsverweigerung war ein untrennbarer Bestandteil der 68er-Bewegung.
Welche Bedeutung hatte '68?
Der Studentenrevolte gelang es erstmals in der Geschichte der BRD, die zuvor in zwei Nachkriegsjahrzehnten entwickelte Staatsräson des Antikommunismus zu durchbrechen. Mit den Mitteln der direkten Aktion und der damit verkoppelten Aufklärung über gesellschaftliche Zwangsverhältnisse durchbrach sie die bis dahin geltenden gesellschaftlichen Spielregeln der spätkapitalistischen BRD. Darin brach erstmals wieder der Antagonismus von Klassen auf, der zuvor mit der »Wirtschaftswunderideologie« verdeckt werden konnte.
Die Revolte entwickelte einen neuen Begriff von einer kompromißlosen politischen Moral. Sie lehnte sich gegen die Elterngeneration, die vorgab, bloß bewußtlos tätiges Opfer der Geschichte zu sein, und Auschwitz zu verantworten hatte, auf. Sie nahm für sich in Anspruch, als handelndes Subjekt bewußt dabei den eigenen Alltag verändernd in die Geschichte einzugreifen. In der Öffentlichkeit wurden politische und soziale Kontinuitäten vom Faschismus zur BRD thematisiert.
Die 68er Revolte formulierte für die gesellschaftliche Wirklichkeit der BRD und West-Berlin neuartige Fragen und Ansprüche. Sie war die »Artikulation eines kulturellen Unbehagens, das Aufdecken von kollektiven Verdrängungsprozessen, das Einklagen einer politischen Moral, die Kritik an einer repressiven Sexualerziehung, an den Normen einer Konsum- und Leistungsgesellschaft« (Kraushaar).
Auf ihrem Höhepunkt im Frühjahr/Sommer 1968 weitete sich die Revolte von der Uni in andere Teile der Gesellschaft aus und verknüpfte sich dort mit subversiven und systemsprengenden Verhaltensweisen von Arbeiterjugendlichen. In diesen Momenten gelang es der von antiimperialistischen, antikapitalistischen und kulturrevolutionären Elementen bestimmten Bewegung wieder, eine radikal oppositionelle Politik gegen die in der BRD und West-Berlin herrschenden Verhältnisse herzustellen.

La sola soluzione la rivoluzione:
Das Beispiel der italienischen Autonomia
Der Begriff der »Autonomie« wie er uns heute in der Politik einer autonomen Bewegung in der BRD gegenübertritt, ist zweifellos durch die Praxis der Studenten-, Arbeiter- und Jugendrevolten im Italien der 60er und 70er Jahre beeinflußt. Die »Autonomia« erhielt ihre Bedeutung in einer von den traditionellen Arbeiterorganisationen unabhängigen, subversiv-militanten Praxis der dortigen Betriebs- und Stadtteilkämpfe ab Ende der 60er Jahre. Dabei fielen in diesem Zeitraum Teile und Ausläufer der Studentenrevolte mit militanten Arbeiterkämpfen vorwiegend in Norditalien zusammen. Die sichtbar gewordene Verknüpfung der politischen Tätigkeit von studentischen Gruppen mit weiten Teilen einer antikapitalistisch revoltierenden Arbeiterklasse übte in der Folgezeit für einige linksradikale westdeutsche APO-Gruppen eine große Faszination aus, die die italienische Entwicklung intensiv verfolgten und diskutierten.
Was passierte in Italien in den 60er Jahren?
Die Arbeiter- und Studentenrevolten trafen in Italien in den Jahren 1968/69 auf ganz andere gesellschaftliche Bedingungen als in der BRD. Italien lag mit seiner Wirtschaftsstruktur als ökonomisch schwächstes Glied der EG quasi an der europäischen Peripherie. Der Staat nahm in der internationalen Arbeitsteilung einen untergeordneten Rang ein. Darüber hinaus war das Land strukturell in zwei Teile gespalten: Der an modernste kapitalistische Produktions- und Arbeitsorganisationen orientierten ökonomischen Entwicklung in Norditalien standen in Süditalien Verhältnisse mit zum Teil feudalistischen Eigentumsstrukturen in der Landwirtschaft gegenüber.
Die Klassenkämpfe wurden gemeinsam von Gruppen aus der Studentenrevolte und vorwiegend ungelernten Fließbandarbeitern aus den norditalienischen Großfabriken getragen. Diese Klassenbewegung war bereits zu Beginn der 60er Jahre von einigen Gewerkschaftlern und linken Intellektuellen im Umkreis der Kommunistischen Partei Italiens (PCI) und der Sozialistischen Partei (PSI) in einer Reihe von Analysen theoretisch vorweggenommen worden. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang inbesondere die Arbeiten und Schriften der Theoretiker Raniero Panzieri, Mario Tronti, Roberto Alquati und Toni Negri, die zunächst in der Zeit von 1961 bis 1964 in der Zeitschrift »Quaderni Rossi« und nach einer Spaltung nachfolgend in der bis 1967 existierenden Theorieschrift »Classe operaia« publizierten.
Nach dem Scheitern von Erneuerungsbestrebungen innerhalb der beiden traditionellen Organisationen der italienischen Arbeiterklasse in der zweiten Hälfte der 50er Jahre verlegten diese Intellektuellen den Schwerpunkt ihrer Arbeit auf die außerinstitutionelle Ebene, um von dort aus ihre Kritik an den offiziellen Apparaten der Arbeiterbewegung fortzusetzen. Ende 1959 ging Panzieri von der Parteizentrale des PSI in Rom nach Turin, »um dort die Arbeiterklasse in der Fabrik wiederzufinden« (Rieland). Die 1962 sich tagelang hinziehenden militanten Auseinandersetzungen von tausenden von FIAT-Arbeitern in Turin auf der Piazza Statuto konnte die Gruppe um Panzieri als Bestätigung für ihre zuvor getroffenen theoretischen Annahmen eines Arbeiterkampfes ohne die reformistische Vermittlung durch die Organisationen der Arbeiterbewegung nehmen: Die Straßenschlachten anläßlich der Unterzeichnung eines Tarifvertrages fanden ohne Unterstützung der Industriegewerkschaften statt, die sich zudem noch entschieden davon distanzierten. In den Kämpfen tauchte ein neuer Arbeitertyp auf, der nicht mehr die Merkmale des alten Facharbeiters aufwies. Als vor kurzem aus dem Süden eingewanderter Fließbandarbeiter ohne Qualifikation gehörten diese Demonstranten zur »Generation mit gestreiften T-Shirts«. Die Auseinandersetzungen auf der Turiner Piazza Statuto drückten erstmals auf politischer Ebene die Neuzusammensetzungsprozesse der Arbeiterklasse in den norditalienischen Großfabriken aus.
Vom Marxismus zum Operaismus
Die bereits zu Anfang der 60er Jahre sich andeutende Entwicklung führte in den theoretischen Diskussionen zu einer vollständig neuen Aufarbeitung und Kritik der innerhalb der italienischen kommunistischen Bewegung vorherrschenden Marxorthodoxie. Mit Hilfe einer Neulektüre des »Kapitals« und der »Grundrisse« von Marx wurde den traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung (PCI, PSI und Gewerkschaften) das Recht strittig gemacht, sich selbst als zentrales Subjekt politischer Auseinandersetzungen zu begreifen. Nicht die Vermittlungsorgane der Arbeiterbewegung wurden als bestimmend in den politischen Kämpfen angesehen, sondern die Arbeiter in den Fabriken und im Stadtteil, und zwar an den Orten des alltäglichen Klassenkampfes. Diese Theorieansätze wurden zugleich mit Untersuchungen der konkreten Zusammensetzung der Arbeiterklasse in einigen italienischen Großfabriken, so z.B. bei FIAT in Turin, verbunden. Dieser Zweig der theoretischen marxistischen Diskussion wird später der »Operaismus« genannt, der zu jener Zeit die radikalste Kritik von »links« an der herkömmlichen Aufnahme der marxistischen Theorie in den Konzepten der traditionellen Arbeiterorganisationen darstellt. Der Operaismus arbeitete in seinen Analysen die Gewaltförmigkeit der alltäglichen kapitalistischen Maschinerie in der Fabrik und im Stadtteil heraus. Dabei ging es diesem Theorieansatz nicht mehr um die von den traditionellen Arbeiterorganisationen propagierte Teilhabe an der kapitalistischen Entwicklung. Die vollständige Negation des Bestehenden wurde als unverzichtbares Primat angesehen, um schließlich zu einer sozialistischen Transformation der Gesellschaft zu gelangen. In diesem Kontext schlugen die Operaisten eine »strategische Umkehr« in der Marxrezeption vor: Wurde die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaften bislang in der Beziehung zwischen Kapital und Klasse als von den Kapitalbewegungen bestimmt betrachtet, so gehen sie davon aus, daß die Kapitalbewegungen durch die Bewegungen der Klasse bestimmt sind. Eine revolutionäre Strategie könne sich daher nur noch auf den »subjektiven Faktor« der Arbeiterklasse stützen, da die Arbeitskraft als einziges Element in der kapitalistischen Entwicklung nicht kontrollierbar sei. Daraus folgt, daß der Kapitalismus nur durch den bewußten Akt des tätigen Handelns der Arbeiterklasse überwunden werden kann.
»Die operaistische Interpretation Marxscher Schriften setzt sich von der bis dahin vorherrschenden Interpretation des Marxismus als 'realistische' Auffassung der Geschichte bzw. als Philosophie ab und rückt die 'Kritik der politischen Ökonomie' in den Vordergrund. Ansätze, die sich auf die Entfremdungsproblematiken in den philosophisch-ökonomischen Manuskripten beziehen wie z.B. die Frankfurter Schule , werden im allgemeinen als 'bürgerlich existentialistisches Denken' (Tronti) und als 'mystisch-magische Weltkonzeptionen' (Colletti), die die Relevanz des Arbeiterantagonismus nicht zu erfassen vermögen, kritisiert. Das Verdienst des 'Frankfurtismus' sei es allerdings, die Wichtigkeit des subjektiven Faktors herausgearbeitet zu haben ... In der Betonung der kämpferischen Subjektivität nicht des Individuums, sondern der 'Klasse' liegt der Schlüssel zum Verständnis des 'operaismo'. Seine Revolutionsvorstellungen basieren auf der 'Insubordination der Arbeiter', d.h. auf dem Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit: Konzeptionen, die sich auf den technologischen Fortschritt als wichtigste Voraussetzung für die (allmähliche) Entwicklung zum Sozialismus gründen, werden als 'objektivistische Ideologien' (Panzieri) abgetan« (Bierbrauer).
In ihren theoretischen Arbeiten stützten sich die Operaisten nicht mehr auf den qualifizierten Facharbeiter, sondern auf den dequalifizierten und am Fließband ausgepreßten Massenarbeiter (operaio massa). Daraus formulierten sie die Forderung nach einer Arbeiterkontrolle über den kapitalistischen Arbeitsprozeß in der Fabrik als ein politisches Instrument zur Herbeiführung eines revolutionären Durchbruches. Der Theorieansatz des Operaismus verknüpfte sich in der Revolte 68/69 massenhaft mit den unmittelbaren Erfahrungen der Fließbandarbeiter in den Großfabriken. Die Klassenkampfaktionen führten auch aufgrund der besonderen sozialen Ausgangsbedingungen in Italien (Nord-Süd-Konflikt, Tradition des militanten und bewaffneten Widerstandes gegen den Faschismus, eine starke KP) zu historisch bisher nicht gekannten Formen des Kampfes in der Fabrik und im Stadtteil. Die Situation der Fließbandarbeiter war gerade in den Automobilfabriken bei FIAT (dem »Herz des italienischen Kapitalismus«) dadurch gekennzeichnet, als kleines Anhängsel einer gigantischen Maschinerie der Massenproduktion dazu gezwungen zu sein, bis zur psycho-sozialen Erschöpfung in millionenfacher Wiederholung ständig die gleichen primitiven Tätigkeiten auszuführen. Dabei verlor die Arbeit jeden Sinn als produktive Tätigkeit, und so richtete sich der ganze aufgestaute Haß der Arbeiter nicht nur allein gegen die Verfügungsgewalt der Kapitalisten über die Produktionsmittel, sondern gleich direkt gegen die Organisation der Arbeit. Zeitweise verloren die traditionellen Arbeiterorganisationen jegliche Kontrolle über die revoltierenden Fließbandarbeiter, die sich während ihrer Fabrikkämpfe autonom in überall gegründeten Basiskomitees organisierten und Delegierte mit einem imperativen Mandat in die Arbeitervollversammlungen entsendeten. Ihre Aktionen zeichneten sich durch eine große Flexibilität, Unberechenbarkeit und Militanz aus: Es fanden wilde Streiks statt, die zusammen mit einem enormen Ausmaß an gezielten Sabotageaktionen weite Teile der Produktion lahmlegen konnten. Zudem waren die Kämpfe von einem wachsenden Absentismus (Krankfeiern) in den Fabriken begleitet. Die Fabrikkämpfe weiteten sich schließlich bis zum Herbst 1969 in einem ungeahnten Ausmaß im Verlauf von Tarifauseinandersetzungen aus, auf deren Höhepunkt es zu einem landesweiten Generalstreik mit einer am 25. September 1969 mit 600.000 Metallarbeitern durchgeführten Demonstration in Turin kam.
Von der Niederlage des 'Operaio massa'
zum 'Operaio sociale'
Die autonome Arbeiterbewegung konnte in Italien jedoch in der Folge durch eine veränderte Politik der Gewerkschaften wieder in die herkömmlichen Formen der Gewerkschaftsarbeit integriert werden. Viele Basiskomitees wurden als untere Ebene in die Gewerkschaftsstrukturen übernommen. Das ist u.a. darauf zurückzuführen, daß sich mit der Ausweitung der Bewegung im »Heißen Herbst 1969« zugleich auch das Problem der Führung dieser Massenaktionen stellte, das durch die Politik der autonomen Arbeiterkerne nicht beantwortet werden konnte. Diesen offenen Raum nutzten die traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung für ihre Politik. Im Jahre 1970 mobilisierte die KPI unter der Parole: »Vom Kampf in den Betrieben zum Kampf für die Reformen«. Zwar gab es auch weiterhin in den norditalienischen Fabriken harte Auseinandersetzungen, die militanten Arbeiterkämpfe hatten jedoch ihren politischen Höhepunkt überschritten. Mit der von der herrschenden Klasse gesteuerten »Strategie der Spannung« wurde mit Hilfe von Geheimdienstaktionen, die der autonomen Linken in die Schuhe geschoben wurden, im Land ein reaktionäres Klima erzeugt: So wurde Ende des Jahres '69 inmitten des Zentrums von Mailand in einer Bank eine Bombe gezündet, durch die 16 Menschen starben. Diese Strategie diente dazu, die vielfältigen politischen und sozialen Widersprüche von Teilen der italienischen Gesellschaft, wie z.B. die Arbeitslosen Süditaliens, die Kleinbauern, das Landproletariat sowie die städtischen Mittelschichten, gegen die revolutionäre Bewegung von 68/69 auszuspielen.
Trotz des »Roll backs« der Reaktion konnte die autonome Arbeiterbewegung noch Teile der Produktionsabläufe in den Großfabriken kontrollieren. Dagegen richtete sich seitens der Kapitalisten in den Folgejahren eine gezielte Strategie der Dezentralisierung der Fabrikproduktion, die die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der autonomen Arbeiterbewegung unterlief.
Im Jahre 1973 löste sich mit »Potere Operaio« die größte der linksradikalen Gruppierungen der militanten Arbeiterkämpfe aus den 60er Jahren auf, da sie mit ihren bislang praktizierten Organisations- und Aktionsformen gegen die neue Strategie des Kapitals innerhalb der Fabrik keine wirksame Antwort mehr entwickeln konnte. Bei FIAT wurde spätestens Mitte der 70er Jahre mit einer massiven Umstrukturierungswelle begonnen, gegen die sich aber innerhalb der Fabrik kein Widerstand entfaltete, da die vorbereitende Umstrukturierung außerhalb der Produktion stattfand. FIAT begann mit der beschleunigten Entwicklung von Industrierobotern, die mit einer Auslagerung sowie Diversifizierung der Produktion verbunden wurde. Durch diese Maßnahmen wurden die autonomen Arbeiter genau an der Stelle entmachtet, wo sie jahrelang stark waren an ihrer Arbeitsstelle.
Der Prozeß der Dezentralisierung und Automation der Großindustrieproduktion führte einerseits zu einer drastischen Verringerung von Arbeitsplätzen im formellen Sektor, andererseits zu einer enormen Ausweitung der Produktion in Kleinstfabriken und Heimarbeitsstätten. Diese Tendenz wurde von operaistischen Theoretikern wie z.B. Negri unter den Begriff »Fabrica diffusa« gefaßt. Er versucht eine ökonomische Entwicklung im Italien der 70er Jahre zu beschreiben, die einhergeht mit einer starken Ausweitung eines »marginalen Proletariats«. Dieses fiel in seiner ökonomischen und politischen Bedeutung besonders in Italien ins Gewicht: Ende der 70er Jahre wurde das marginale Proletariat auf ca. neun Millionen Menschen geschätzt. Darunter sind hauptsächlich Jugendliche, Alte und Kranke zu verstehen, die durch die Dezentralisierung der Großindustrieproduktion aus stabilen Beschäftigungsverhältnissen gedrängt wurden und entweder ständig ungesichert beschäftigt oder arbeitslos und damit auf staatliche Unterstützung angewiesen waren. Hinzu kommen noch zehntausende von Studenten und Akademikern, die nach dem Bildungsboom in den 60er Jahren auf einen Arbeitsmarkt stießen, der in den entsprechenden Sektoren z.B. in der staatlichen Bürokratie schon lange an seine Grenzen gestoßen und für die Universitätsabsolventen geschlossen war.
Jener Flügel der operaistischen Theorie, der weiterhin auf eine revolutionäre Organisierung jenseits aller bestehenden Organisationen drängte, verschob seinen Ansatz vom »Operaio massa« des Massenarbeiters als bestimmende soziale Figur der Klassenkämpfe in den 60er Jahren hin zur sozialen Figur des »Operaio sociale«, dem gesellschaftlichen Arbeiter. In diesem theoretischen Ansatz wird der Kampf von der Fabrik (aus der Produktion) in die Gesellschaft ausgeweitet. Damit reagiert der Ansatz des »Operaio sociale« sowohl auf die Zerstreuung der Produktion in den Regionen als auch auf die Revolte der Frauen und die Bewegung der Jugendlichen.
Entstehung und Zerfall der 77er Autonomia-Bewegung
Im Jahre 1977 entwickelte sich eine zweite massenhafte Bewegung der Autonomia. Sie bezog sich jedoch in ihren Subjekten nicht mehr auf die Fabrikarbeiter, sondern auf das marginale Proletariat von Studenten, jugendlichen Arbeitslosen, prekär Beschäftigten und alten politischen Kernen der Autonomia aus den 60er Jahren. Im Unterschied zur »alten« autonomen Klassenbewegung, die auf einen Bruch zwischen der Basis der traditionellen Arbeiterorganisationen zu deren Führung abzielte, war diese Bewegung zugleich strikt antiinstitutionell und antikommunistisch gegen die Politik der PCI gerichtet. Die neue Bewegung drückte sich im Jahre 1977 in einer ungeheuren Intensität von kreativen und militanten Formen des Protests und Widerstands gegen den Staat aus. Zentren der Revolte waren die Universitäten und die norditalienischen Großstädte. Die Bewegung bestand im wesentlichen aus zwei Strömungen: Ein Zweig war die »Autonomia creativa«, sozusagen die Spontis, die gegen die herkömmlichen Formen der Machtkämpfe mit dem Staat waren und konventionelle Organisationsstrukturen sowie kontinuierliche politische Arbeit ablehnten und den Straßenkampf mehr als Happening denn als politische Aktion begriffen. Daneben existierten auch weiterhin die Gruppen der »Autonomia operaia«, die versuchten, die verschiedenen Teile der Bewegung zu organisieren, um die spontane Revolte zu einem kontinuierlichen Angriff auf das kapitalistische System umzuwandeln.
Innerhalb der »Autonomia creativa« fanden sich vor allem zwei wesentliche Ausdrucksformen: die »Circoli del proletario giovanile« und die »Indiani Metropolitani«. Erstere entwickelten sich seit 1975 als spontane und lockere Organisation von Jugendlichen in den am meisten von der ökonomischen Marginalisierung betroffenen Vororten der Großstädte. Sie propagierten die Politik der unmittelbaren Wiederaneignung des eigenen Lebens (Politica di riappropriazone), die im scharfen Widerspruch zu der von der PCI damals unterstützten Austeritätspolitik, des Programms der moralischen Strenge und des ökonomischen Verzichts, stand. Dagegen setzten die »Circoli« ihre eigene Praxis, die u.a. darin bestand, massenhaft in Supermärkten »proletarisch« einzukaufen, d.h. zu plündern, Jugendzentren als kollektiven Treffpunkt zu besetzen, die Zerstörung der eigenen sozialen Strukturen durch Heroinkonsum zu bekämpfen, indem man Heroindealer überfiel und verprügelte, sich den kostenlosen Eintritt zu Musikkonzerten zu verschaffen, sowie umsonst die öffentlichen Verkehrsmittel und Kinos zu benutzen. Über das Selbstverständnis der »Circoli« nachfolgend ein Zitat aus dem »Communiqué 1« zur Stürmung des Umbria Jazz Festivals im Sommer 1975:
»Die Waffe der Musik kann die Musik der Waffen nicht ersetzen. Umbria Jazz. Die Musik als Spektakel ist der Versuch, jedes Moment der Kollektivierung auf Frei/Zeit zu reduzieren. Zwischen den Organisatoren des Konzerts und den Massen der proletarischen Jugendlichen gibt es einen objektiven Widerspruch; das ist nicht einfach eine Frage der Leitung, es geht nicht nur darum, wer an der Musik verdient. Das Problem ist nicht, selbstverwaltete Konzerte zu machen. Das Problem ist, daß uns das Konzert die Musik als Spektakel vorsetzt, wie uns die ritualisierten Demos und Kundgebungen die Politik als Spektakel vorsetzen. Wir müssen uns in jedem Fall auf Zuschauer, auf Publikum reduzieren.
In diesen Momenten der Konzentration dagegen können Spannungen explodieren, die die Bedürfnisse und Potenzen des jugendlichen Proletariats repräsentieren« (A/traverso, Juni '75).
Aus den Reihen dieser Autonomiaströmung wird im Dezember 1976 auch der Sturm von mehreren tausend proletarischen Jugendlichen auf die Mailänder Scala organisiert, der mit einer Plünderung von Luxusgeschäften in der Innenstadt endet.
Die »Indiani Metropolitani« wirkten hauptsächlich im Umkreis der Universitätsstädte und drückten in ihren Gesten ihre Verbundenheit mit »Naturvölkern« als radikale Negation der großstädtischen und kapitalistischen Lebensweise aus. In der Autonomiarevolte '77 waren sie vor allem die Träger der alternativen Werte (Ökologie, alternative Ernährung, sexuelle Befreiung), die jegliche instrumentelle Vernunft ablehnten und u.a. das befreiende Potential des Haschischkonsums propagierten. Aus dem »Manifest der 'Indiani Metropolitani'« von Rom:
»10, 100, 1.000 Hände haben sich überall geballt, um das Kriegsbeil zu erheben! Die Zeit der Sonne und der tausend Farben ist angebrochen ... Es ist die Zeit, daß das Volk der Menschen in die grünen Täler hinabsteigt, um sich die Welt zurückzuholen, die ihm gehört. Die Truppen der Bleichgesichter mit ihren blauen Jacken haben all das zerstört, was einst Leben war, sie haben mit Stahl und Beton den Atem der Natur erstickt. Sie haben eine Wüste des Todes geschaffen und haben sie 'Fortschritt' genannt.
Aber das Volk der Menschen hat zurückgefunden zu sich selbst, zu seiner Kraft, seiner Freude und zu seinem Willen zu siegen, und lauter denn je schreit es mit Freude und Verzweiflung, mit Liebe und Haß: Krieg!!!« (»Lotta Continua«, 1.3.1977).
Die »Autonomia creativa« fand zu jener Zeit ihren reichhaltigen Ausdruck in hunderten von alternativen Presseorganen und über 50 linksradikalen Radiostationen, von denen »Radio Alice« in Bologna das bekannteste wurde. Es gab eine Vielfalt von Wandmalereien, Straßentheatern und Massenfestivals. Zentraler politischer Inhalt dieser Strömung ist die Politik der Freiräume, in denen die alltäglichen Bedürfnisse politisiert und in kollektiven und selbstbestimmten Formen ausgelebt werden. Insbesondere die Figur des »Stadtindianers« wird 1977 in der bundesdeutschen Spontiszene begeistert aufgenommen.
Demgegenüber versucht der andere Hauptstrang der 77er-Bewegung, die »Autonomia operaia organizzata«, weniger die Flucht aus dem System als vielmehr dessen bedingungslose Zerstörung zu praktizieren. Sie setzte sich aus einer Vielzahl von locker koordinierten Komitees, Zirkeln und Kollektiven zusammen, in denen auch die Reste der verschiedenen 69er-Basiskomitees aus den italienischen Fabriken mitarbeiteten, so z.B. auch viele Mitglieder von »Potere operaio«, die sich im Jahre 1973 in die Bewegung außerhalb der Fabriken aufgelöst hatten.
Im Frühjahr 1977 explodierte die neue Bewegung in einem ungeahnten Ausmaß: Ausgelöst durch die Abschaffung einiger Feiertage sowie durch ein geplantes Gesetz zur Universitätsreform, begannen Studenten in Palermo, Catania und Neapel mit Universitätsbesetzungen. Die Bewegung breitete sich schnell über ganz Italien aus. Nach einem bewaffneten faschistischen Überfall auf eine Vollversammlung der Universität in Rom am 1. Februar kam es am Tag danach zu einer Demonstration von tausenden von Studenten, die von den Bullen mit Pistolen und Maschinengewehren angegriffen wurde. Erstmals machten dabei auch Demonstranten von der Schußwaffe Gebrauch. Bei den folgenden militanten Autonomendemonstrationen kam es in Italien immer häufiger zur Anwendung von Schußwaffen seitens der Demonstranten; die »P 38« wurde zu einem Erkennungsmerkmal der Bewegung. Nach der Demonstration in Rom wurde die Universität von den Studenten besetzt. Dort kam es auch am 17. Februar zu einem Ereignis, das symbolisch den Bruch zwischen der organisierten Arbeiterklasse und der 77er-Bewegung der italienischen Autonomia demonstrierte: Bei dem Versuch des Vorsitzenden der kommunistischen Gewerkschaft, Lama, in der Universität eine Rede zu den Problemen der Studenten zu halten, wird dieser von vier- bis fünftausend StudentInnen und Jugendlichen empfangen, die sein Ebenbild als große Puppe schwenken und ihn mit Spottversen überhäufen. Zwischen dem herbeigekarrten gewerkschaftlich-kommunistischen Ordnungsdienst und den StudentInnen kam es dabei während der Rede Lamas zu Schlägereien, als dieser an die Adresse der Studenten die klassischen Angriffe der »Wohlfahrtsideologie« und des »Parasitismus auf Kosten der produktiven Arbeit« richtete, die angesichts der realen sozialen Situation der Studenten von diesen als glatter Hohn empfunden wurden. Den autonomen Studenten gelang es im Laufe einer Massenprügelei, den »superbonzo« Lama vom Universitätsgelände zu vertreiben, was von ihnen als »la Piazza Statuto dell'operaio sociale« gefeiert wurde.
In der Folgezeit überstürzten sich die Ereignisse. Nachdem es in Bologna, in der Musterstadt einer kommunistischen Kommunalverwaltung, schon den ganzen Winter zu Hausbesetzungen, Plünderungen von Restaurants, Besetzungen von Kinos usw. gekommen war, eskalierte die Situation am 11. März. Während eines Bulleneinsatzes auf dem Unicampus wurde ein Autonomer erschossen. Daraufhin kam es zu tagelangen schweren Straßenschlachten, in deren Verlauf eine Waffenhandlung geplündert wurde. Es gelang den StudentInnen in der verwinkelten Altstadt Bolognas mit Barrikaden drei Tage lang ein bullenfreies Gebiet zu halten, bevor das Gelände mit Militäreinheiten geräumt werden konnte.
Am 12. März kam es in Rom zu einer Demonstration von über 50.000 Menschen gegen die Verurteilung eines Anarchisten. Diese Demonstration eskalierte in eine der größten Straßenschlachten, die die italienische Hauptstadt jemals erlebt hatte. Dabei praktizierten Gruppen aus dem Strang der »Autonomia operaia organizzata« das von ihnen zuvor propagierte »neue Niveau der Auseinandersetzung«, die bewaffnete Aktion. Während der Demonstration wurden zwei Waffengeschäfte geplündert, unzählige Geschäfte, Cafés und Hotels verwüstet, hunderte von Autos und viele Busse umgestürzt und verbrannt. Büros und Zeitungen der regierenden Christdemokratischen Partei (DC) wurden mit Benzinbomben angegriffen. Der Ablauf dieser Demonstration markierte jedoch einen Wendepunkt in der weiteren Entwicklung der italienischen Autonomia. Viele DemonstrationsteilnehmerInnen fühlten sich durch die Dimension der Militanz überrumpelt und funktionalisiert, dies umso mehr, als der Großteil von ihnen dem militärischen Auftreten der Polizei und deren Racheaktionen nach Ende der Demonstration relativ unvorbereitet und hilflos gegenüberstand.
Die Entwicklung spitzte sich schließlich am 14. Mai bei einer Demonstration in Mailand zu. Gruppen von mit Knarren bewaffneten Jugendlichen griffen die Bullen an und töteten einen. Die Ereignisse führen zu einer verschärften Isolation der organisierten »Autonomia operaia« innerhalb der italienischen Linken. Mit einer zunehmenden Entsolidarisierung und einer massiven staatlichen Repression ging zugleich ein Zerfall des kreativen Strangs der Autonomia einher, der sich, durch staatliche Zugeständnisse begünstigt, in die Drogensubkultur der Großstädte, auf das Land oder in die Radikale Partei (in etwa vergleichbar mit den Grünen) zurückzog. Unter maßgeblicher Mithilfe der PCI, die in ihren Zeitungen die Namen von »Rädelsführern« der Autonomia abdruckte, wurden bis zum Sommer 1977 über 300 Autonome vom italienischen Staat in den Knast gesteckt, »Radio Alice« in Bologna wurde verboten und dessen Sendeeinrichtungen beschlagnahmt. Die staatliche Repression richtete sich gezielt gegen die Strukturen der Bewegung, wie z.B. Buchläden, Verlage, Zeitungsredaktionen usw. Vorwand aller Maßnahmen war die Konstruktion einer »subversiven Vereinigung«, die ein Komplott gegen den italienischen Staat vorbereitet haben sollte.
Weite Teile der Aktivisten aus dem Umfeld der »Autonomia operaia« versuchten, den Zerfall der Bewegung durch eine Steigerung der klandestinen Massengewalt (»Guerilla diffusa«) aufzuhalten und sahen nur noch in der militärischen Konfrontation mit dem Staatsapparat die Möglichkeit zur Entfaltung eines revolutionären Prozesses. »Ganze Vollversammlungen gehen in den Untergrund.« Diese Linie konnte jedoch die schwindende soziale Verankerung der politischen Bewegungen nicht mehr ersetzen. Am 7. April 1979 kam es schließlich zu hunderten von Verhaftungen (darunter auch Negri) gegen die »Autonomia operaia«. Von den 4.000 politischen Gefangenen des Jahres 1981 in Italien gehörten weit über 1.000 dieser Gruppierung an. Die Ereignisse vom 7. April 1979 wurden so zu einer strategischen Niederlage der italienischen »Autonomia operaia«, von der sie sich in den 80er Jahren nicht wieder erholt hat.
Dessen ungeachtet spielte und spielt die Rezeption des operaistischen Theorieansatzes für die bundesdeutsche autonome Linke in ihrem eigenen Selbstverständnis eine große Rolle. Bis zum Ende der 70er Jahre wurden so gut wie alle wichtigen Schriften aus dieser marxistischen Strömung ins Deutsche übersetzt. Die Schwierigkeiten der Vermittlung dieses Ansatzes in eine politische Praxis von linksradikalen Gruppierungen in der BRD werden in den nachfolgenden Kapiteln immer wieder von neuem gestreift.

Querbeet durch den Linksradikalismus
der 70er Jahre
Die Jahre 1969-73 in der BRD waren die Zeit der »Reformeuphorie« und des »Friedenskanzlers« Willy Brandt, der eine neue Ostpolitik einleitete. Die JUSOS erlebten in dieser Phase einen Boom mit 100.000 neuen Mitgliedern. Politisch verfolgten sie im Umgang mit innen- und sozialpolitischen Konflikten die sogenannte »Doppelstrategie«, um Basis- und Selbsthilfeaktionen von autonomen Initiativen für die eigene Politik zu vereinnahmen.
Im Zerfallsprozeß der Studentenrevolte waren die unorganisierten Antiautoritären jenseits von JUSOS, der DKP und der ML-Gruppierungen die vierte Hauptströmung. Inhaltliche Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedensten antiautoritären Gruppierungen zu Beginn der 70er Jahre bestanden darin, keine wie auch immer geartete »Avantgarderolle« oder »Führung des Proletariats« auszuüben. Ihre politische Praxis zielte auf eine »Politisierung« des eigenen Alltags ab. Sofern die antiautoritären Gruppierungen nicht an der Uni verblieben, arbeiteten sie in einer Vielzahl von Kinderläden, Selbsthilfegruppen, selbstverwalteten Jugendzentren, Stadtteilgruppen oder in der Randgruppenarbeit.
Die militanten Basisströmungen fanden in der Zeit von 1969-72 ihren prägnantesten Ausdruck in der West-Berliner Zeitung »883«. Sie war das Sprachrohr der militanten Subkultur in der Stadt, der Bluesszene. Deren Aktivitäten reichten von Anschlägen auf Banken, Wohnungsbauorganisationen bis hin zu Demonstrationen vor Erziehungsheimen und »Smoke ins«.
In ihrem Inhalt grenzte sich »883« zunehmend von der in West-Berlin dominanten ML-Organisation KPD-AO (A-Null im Jargon der Linksradikalen) ab. Als praktische, antiautoritäre und militante Alternative zu den dogmatischen Parteikonzepten gingen dann später eine Reihe von bei »883« tätigen GenossInnen in den Untergrund, so z.B. Georg von Rauch, Tommie Weisbecker, Holger Meins, Werner Sauber, Peter Paul Zahl. Der Lebensweg der genannten Genossen läßt sich aber kaum auf die Entwicklung des gesamten antiautoritären Lagers zu Beginn der 70er Jahre verallgemeinern.
Um 1970 entstanden die Kürzel »Sponti« und »Anarcho«, die zumeist eher informelle Gruppen, insbesondere Stadtteilgruppen bezeichneten. Viele der nichtorganisierten GenossInnen sympathisierten z.B. in West-Berlin mit der »Proletarischen Linken/Parteiinitiative« (PL/PI). Für eine kurze Zeit in den Jahren '71/'72 verband sie eine leninistische Propaganda mit einer spontaneistisch orientierten militanten Linie des Betriebsinterventionismus.
Aus den sich selbst als undogmatisch verstehenden Zirkeln in der Universität spalteten sich eine Reihe von Gruppen ab, die im Jahre 1973 in den Bezirken Kreuzberg und Wedding Stadtteilarbeit betrieben. Aus diesem Zusammenhang wurde im Februar 1974 das »Info Berliner Undogmatischer Gruppen« (INFO-BUG) gegründet, das bis zum Ende der 70er Jahre das wichtigste Sponti-Organ in West-Berlin blieb.
Die nachfolgenden Kapitel sind als Beschreibung unterschiedlicher Konzeptionen der radikalen Linken in den 70er Jahren zu verstehen, politisch, praktisch, sozial und theoretisch verändernd auf die gesellschaftliche Realität der West-BRD einzuwirken. In je eigener Weise haben die nachfolgend dargestellten Ansätze mit ihren jeweiligen Theorien, konkreten Praxen und Wirkungen Einfluß auf die Entwicklung sowohl des antiautoritären Lagers in den 70ern als auch zum Teil auf die Vorstellungen der Autonomen in den 80er Jahren genommen. Die Fernwirkungen dieser Ansätze gelten sogar in besonderer Weise, selbst wenn sie den zu Beginn der 80er Jahre neu beginnenden jungen Aktivistinnen nicht selbst-bewußt gewesen sein können.
Der deutsche Herbst 1977 stellte mit allen seinen Implikationen so etwas wie einen relativen Scheitelpunkt der linksradikalen 68er Bewegung dar. Alle Spektren dieser Bewegung mußten sich zu diesem Ereignis noch einmal verhalten: Und während diese oder jene Grüppchen und Individuen die Gunst der Stunde dafür benutzten, entschlossen wieder zurück in Richtung Staat zu marschieren, versackten andere wahlweise in der (vorläufigen) Ohnmacht, der politischen Isolation oder in dem Aufbau des alternativen Ghettos. Aber dieser »Bruch«, den die Ereignisse im Herbst '77 für die linksradikale Bewegung zweifellos darstellen, wäre kein dialektischer, wenn nicht genau durch ihn hindurch weiterwirkende Tendenzen der Kontinuität wirksam würden So markiert dann das TUNIX-Treffen sowohl das letzte große Sponti-Feuerwerk in der BRD der 70er Jahre als auch das Festhalten an dem kulturell-politischen Impuls, gegen die Verhältnisse nicht einfach klein beizugeben.
Und so finden sich spätestens fünf Jahre nach dem dunklen Loch des »Deutschen Herbstes« und dem TUNIX-Feuerwerk zu Beginn der 80er Jahre die noch übriggebliebenen Aktivisten der 68er Zeit in den verschiedensten Projekten der sich im Aufwind befindlichen autonomen Basisbewegungen, der RAF, der TAZ und der Grünen Partei in neuen Konstellation.
 »Wir wollen alles!« Betriebsprojektgruppen
»Wir wollen alles!« Betriebsprojektgruppen
Eine Richtung des linksradikalen spontaneistischen Lagers orientierte sich zu Beginn der 70er Jahre an den italienischen Klassenkämpfen. Die Gründung der bundesdeutschen operaistischen Gruppen »fiel in das Spannungsfeld zwischen Auflösung der APO und Konstituierung der K-Gruppen« (Bierbrauer). Dabei war ihre Hinwendung zu den Theorien des Operaismus so etwas wie ein Befreiungserlebnis von den dogmatischen Versionen der Marxismusrezeption. Der Operaismus wurde deshalb als Theorie aufgegriffen, da in ihm die Arbeiterklasse nicht als Opfer, sondern als Subjekt ihrer gegenwärtigen Geschichte begriffen wurde.
Es bildeten sich an verschiedenen Orten der BRD sogenannte »Betriebsprojektgruppen«, die unter Namen wie z.B. »Arbeiterkampf« in Köln, »Revolutionärer Kampf« in Frankfurt, »Arbeitersache« in München, »Proletarische Front« in Hamburg und Bremen begannen, die Möglichkeit der praktischen und politischen Intervention in Betrieben und Stadtteilen zu diskutieren und teilweise zu praktizieren. Im Gegensatz jedoch zu den Auffassungen der ML-Gruppierungen, die sich in ihrer Betriebsarbeit an einem undifferenzierten Proletariatsbegriff orientierten, existierte bei diesen Gruppen ein größeres Problembewußtsein über die Transformation der Studentenrevolte in eine betriebliche Klassenkampfpraxis. Angelehnt an die Methoden des italienischen Operaismus sollte die Betriebspraxis zunächst zur Sammlung von Erfahrungen dienen, da sich die Organisationsform, Strategie und Taktik der betrieblichen Klassenkämpfe ihrer Auffassung nach nicht von vorhandenen Konzepten ableiten ließen. Die politische Intervention in einen Betrieb wurde als eine Art »Untersuchungsaufgabe« verstanden, bei der das praktische Eingreifen mit einem Erkennen des tatsächlichen Bewußtseins der ArbeiterInnen verknüpft werden sollte.
In der Zeit von Februar 1973 bis Ende Sommer 1975 gaben die Gruppen eine gemeinsame Zeitung unter dem Titel »Wir wollen alles« (WWA) heraus. Der diese Zeitung tragende Konsens wird von der »Arbeitersache« München im Januar 1973 wie folgt charakterisiert: »Arbeiterautonomie, Primat der Praxis und der Betriebsarbeit, radikale Gewerkschaftskritik, Einbeziehung der Ausländer in den nationalen Klassenkampf, praktische Bezugnahme auf den proletarischen Lebenszusammenhang.«
In ihrer Untersuchung konstatiert jedoch Bierbrauer:
»Bei näherem Hinsehen erwiesen sich aber die Gemeinsamkeiten der an dem Zeitungsprojekt beteiligten Gruppen als eher diffus, sie erschöpften sich fast vollständig in einer auch noch widersprüchlichen Nähe zum italienischen Operaismus. Die Münchener 'Arbeitersache' versuchte mehr oder weniger glücklich, in Betriebskämpfe zu intervenieren ... und die Belegschaft dabei vor allem italienische Arbeitsmigranten zu organisieren, verwandte aber auf die theoretische Fundierung ihrer politischen Praxis weniger Mühe. Der RK, der als Ableger der Frankfurter Sponti-Szene betrachtet werden kann, und die PF Hamburg bezogen sich zwar beide auf Trontis operaistischen Klassiker 'Arbeiter und Kapital', unterschieden sich aber beträchtlich hinsichtlich ihrer politischen Bezugsgruppe: der RK orientierte sich an der spontaneistischen 'Lotta Continua', die PF-HH mehr an der leninistischen Organisation 'Potere operaio'.«
Zwar gelang es, mit der Linie des Betriebsinterventionismus innerhalb der Arbeiterklasse einige punktuelle Mobilisierungserfolge zu erreichen. So organisierte im Oktober 1971 der »Revolutionäre Kampf« einen Sturm von Arbeitsmigranten in Rüsselsheim auf die Opel-Betriebsversammlung. Allerdings erlangten diese Ansätze nicht die erhoffte Ausweitung und schnelle Resonanz. Abgesehen von den praktischen Schwierigkeiten der politischen Arbeit (Überwachung und Repression durch den Werksschutz, Entlassungen usw.) konnten die kulturellen Barrieren zu den »Massenarbeitern« nur punktuell aufgelöst werden.
Wie bereits der Begriff »Betriebsintervention« selbst andeutet, kam in der BRD nach den 69er Septemberstreiks im Gegensatz zu Italien der Impuls zu den Klassenkämpfen in der Fabrik nicht von innen, sondern von studentischen Gruppen. Dabei verlagerten viele Mitglieder der linksradikalen Betriebsprojektgruppen ihren antiautoritären Aktionismus auf die Fabrik. Vermittelnde Instanz zwischen der Kultur der antiautoritären Revolte und der »proletarischen Arbeiterklassenkultur« im Kontext der angestrebten Kämpfe konnte damit jedoch nur die Form der Aktion sein, die Militanz und nicht die Handlungsziele selbst. Dabei kamen in der Betriebsarbeit der linksradikalen Gruppen auch die Probleme mit den im Vergleich zu Italien unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Bedingungen für Arbeiterkämpfe in der BRD zum Ausdruck:
»Zu stark ist der Interessensgegensatz zwischen Massenarbeitern und den für sie bzw. statt ihrer agierenden Organisationen ... Zu oft sind die Massenarbeiter von der Politik und ihren Organisationen verkauft worden, als daß der Avantgardismus der Intellektuellen sie von ihren Sitzen reißen könnte ... Es scheint, als sei der Begriff der 'Arbeiterautonomie' hinsichtlich der Massenhaftigkeit und Radikalität ihres Auftretens den Verhältnissen des Arbeiterkampfes in der BRD aufgesetzt. Damit wird nicht ihre Existenz bestritten; es ist jedoch ein weiter Weg von passiven zu aktiven Formen des Kampfes, und das Fehlen jeder Identifikation mit der Arbeit bedeutet noch lange nicht die Identifikation mit externer Radikalität ... Der 'Revolutionäre Kampf' hat dies selbstkritisch erkannt: Er konstatiert: Die Fehleinschätzung des Radikalismus und der Autonomie der Arbeiterklasse resultiert aus der 'italienischen Illusion'.
Die Entwicklung des Kapitalismus in der BRD ist jedoch grundsätzlich anders verlaufen als in Italien; dort basierte der kapitalistische Aufschwung in den 60er Jahren 'auf einer Ausbeutung des scheinbar unbegrenzten Arbeitskräftereservoirs, auf einer Intensivierung der Arbeit und auf Niedriglöhnen, auf der Proletarisierung von Millionen von Landarbeitern, Kleinbauern und Kleinbürgern nach dem Krieg ...', d.h. vorwiegend auf der Produktion absoluten Mehrwerts, während in der BRD die Produktion relativen Mehrwerts immer eine wesentliche Rolle gespielt hatte und zudem die extensive Akkumulationsstrategie des Kapitals Ende der 50er Jahre beendet war« (Kukuck).
In diesem Zusammenhang bliebt auch die 73er Kampf- und Streikbewegung des »Massenarbeitertypus«, mit ihrem Höhepunkt Ende August beim FORD-Streik in Köln, vorwiegend auf ausländische Arbeitsmigranten beschränkt. Es gelang dieser Streikbewegung nicht, rassistische Spaltungslinien zwischen den ausländischen und deutschen Arbeitern zu durchbrechen, was einer der Gründe ihres Scheiterns war. Zwar fand gerade der FORD-Streik mit seinen vorher in der BRD nicht gekannten, dem DGB-SPD-Gewerkschaftsapparat feindlich gesonnenen autonomen Organisationsformen und Inhalten bei Linksradikalen eine begeisterte Aufnahme. Allerdings erfüllten sich die darein gesetzten Hoffnungen auf eine Ausweitung der gewerkschaftsunabhängigen Massenarbeiterkämpfe in der Fabrik in den Folgejahren nicht mehr. Der FORD-Streik fiel schließlich in eine Situation, in der die Betriebsintervention in der Politik der Betriebsprojektgruppen ohnehin kaum noch eine Rolle spielte. Während die »Proletarische Front« in Hamburg keinerlei praktische Betriebsintervention durchführte, gründete der RK Frankfurt spätestens ab Ende 1970 Stadtteil- und Lehrlingsgruppen und bezog sich auf das Terrain der zu dieser Zeit beginnenden Häuserkämpfe. Die »Proletarische Front« Hamburg folgte dieser Entwicklung im Frühjahr des Jahres 1973.
 Die Häuserkämpfe in den 70er Jahren
Die Häuserkämpfe in den 70er Jahren
Bereits 1970 organisierten Aktivisten aus dem antiautoritären Flügel der Studentenbewegung erste demonstrative Hausbesetzungen u.a. in München, Köln, Frankfurt, Göttingen und Hamburg.
Für die linksradikalen Betriebsprojektgruppen aus dem WWA-Zusammenhang bot sich das Mittel der Hausbesetzungen aus mehreren Gründen als Kampfform an: Einerseits ließ sich damit der »proletarische Lebenszusammenhang« mit einer politischen Praxis thematisieren, andererseits konnten damit die Mobilisierungsschwierigkeiten aus den Betriebskämpfen zunächst überwunden werden.
Ausgehend von der Annahme, daß immer größere Bereiche der Gesellschaft der Kontrolle des Kapitals unterstellt werden dabei illustrierte der damals von den WWA-Gruppen benutzte Begriff der »Wohnfabrik« die Ausdehnung des Kapitalkommandos auf die Gesellschaft werden Wohnheimagitationen, Mietstreikbewegungen und Häuserkämpfe zu Kristallisationspunkten des antikapitalistischen Kampfes in der Reproduktionssphäre:
»Häuser besetzen bedeutet, den kapitalistischen Plan in den Vierteln zu zerstören. Bedeutet, keine Miete zu zahlen, bedeutet, die kapitalistische Schuhkartonstruktur aufzuheben. Bedeutet, Kommunen und Zentren zu bilden, bedeutet, das gesellschaftliche Leben des Stadtteils zu reorganisieren, bedeutet, die Ohnmacht zu überwinden. Im Besetzen der Häuser und in Mietstreiks liegt der Angelpunkt für den Kampf gegen das Kapital außerhalb der Fabriken« (Proletarische Front in WWA Nr. 4, Mai 1973).
Die WWA-Gruppen gingen davon aus, der kapitalistischen Aufteilung des Lebens in Arbeit und Freizeit im Häuserkampf das Bedürfnis der proletarischen Massen nach Kollektivität gegenüberstellen zu können. Dabei wollten sie mit der Form der Häuserkämpfe in zugespitzter Weise eine Einheit zwischen den Interessen von Studenten und Arbeitern (Lebenszusammenhänge, Kommunikationsstrukturen) gegen einen gemeinsamen Gegner herstellen. Dies sollte zugleich noch mit der wechselseitigen Erfahrung von Staatsgewalt und Militanz verbunden werden. Diesem anspruchsvollen theoretischen Ansatz stand aber die Realität der Häuserkämpfe zu Beginn der 70er Jahre gegenüber. Ihre wesentlichste Zuspitzung erhielten diese Kämpfe in den sozialdemokratisch regierten Metropolen Frankfurt und Hamburg. Die Hausbesetzungen stießen dort zum Teil in relative politische Freiräume, die der bürgerliche Staat gewähren mußte, da er in diesen Städten mit einem reformistischen Anspruch auftrat. So hatte es die Hausbesetzerbewegung in Frankfurt mit einer »linken SPD« zu tun, die ebenfalls den Kampf gegen die Bodenspekulation auf ihre Fahnen geschrieben hatte.
In Frankfurt entwickelte sich so etwas wie eine breite soziale Bewegung, während in Hamburg mit der Hausbesetzung in der Eckhoffstr. 39 eine politische Zuspitzung des Kampfes stattfand, die zu einer folgenreichen Niederlage der radikalen Linken in der Stadt wurde. Die Debatten gingen zum Teil weit über die unmittelbare Praxis des Aneignens von leerstehenden Wohnraum hinaus. Sie erhielten für die darauffolgenden Jahre eine strategische Qualität für die Diskussionen über eine linksradikale Politik in der Bundesrepublik.
Die Häuserkämpfe der 70er Jahre zeigten auf, daß es auch in dem Reproduktionsbereich möglich war, neue radikale Kampfformen zu entwickeln, die trotz ihres bewußten Durchbrechens von legalistischen Politikformen zu teilweise breiten Solidarisierungen innerhalb der Bevölkerung führten.
Der Frankfurter Häuserkampf
Ende der 60er wurden von den Großbanken in Frankfurt Konzepte einer Umstrukturierung der Stadt in eine Banken- und Dienstleistungsmetropole entworfen. Die Banken entschlossen sich, in das zur City verkehrsgünstig gelegene Westend-Viertel zu expandieren. Die Sanierung dieses ehemaligen Quartieres der Frankfurter Bourgeoisie erfolgte in mehreren Schritten. Mit Hilfe von Spekulanten wurden ganze Grundstückskomplexe aufgekauft, im zweiten Schritt erfolgte die Einquartierung von Arbeitsimmigranten in die Häuser. Dieser Prozeß beschleunigte die Abwanderung der eingesessenen bürgerlichen Westend-BewohnerInnen und ermöglichte riesige Profite durch Wuchermieten. Zugleich kam es teilweise zu einer katastrophalen Überbelegung ganzer Straßenzüge. Die Situation wurde noch durch spekulativen Leerstand von Häusern verschärft. Zudem war es für Leute aus der Studentenszene in Frankfurt so gut wie unmöglich, große Räume für Wohngemeinschaften zu mieten.
Vor diesem Hintergrund entwickelte sich in den Jahren Ende 1970 bis Anfang 1974 der Frankfurter Häuserkampf, der in der sozialen Zusammensetzung seiner Träger für die Herrschenden geraume Zeit ein brisantes Gemisch bedeutete. Die Initiativen des Häuserkampfs wurden von dem sich antiautoritär verstehenden Teil der Studentenbewegung getragen, der schon zu SDS-Zeiten in Frankfurt bundesweit eine seiner Hochburgen hatte. Aus dem Zerfall des SDS war in dieser Stadt eine zahlenmäßig starke Spontifraktion hervorgegangen. Sie arbeiteten u.a. mit Immigranten zusammen, die zum Teil vorher bei der linksradikalen »Lotta Continua« mitgearbeitet hatten. Zwischen Frühjahr 1972 und Frühjahr 1973 verbanden sich die Mietstreiks, die vorwiegend von türkischen und italienischen Immigranten getragen wurden, mit den Hausbesetzungen der Spontiszene. Allerdings entstanden in der konkreten Zusammenarbeit Probleme: Einer mangelnden politischen Autonomie auf der Seite der Mietstreikenden stand auf Spontiseite eine teilweise »Sozialarbeiter- und Juristenmentalität« gegenüber, die lediglich dazu führte, sich gegenseitig zu funktionalisieren, anstatt den Prozeß der Selbstorganisation in den laufenden Auseinandersetzungen voranzutreiben.
In den Jahren 1971 bis 1974 gelang es der Frankfurter Spontiszene, mit dem »Revolutionären Kampf« als wichtigster Gruppe, durch eine Verbindung der verschiedensten Aktionen, Besetzungen und Demonstrationen den öffentlichen Ausdruck und die Dynamik des Häuserkampfes zu bestimmen. Insbesondere in dem Gebrauch der Militanz in diesen Kämpfen kommen ihre widersprüchlichen Seiten zum Ausdruck: Während der ersten größeren Straßenschlacht Ende September 1971 bei einem gescheiterten Besetzungsversuch kam es zu einer Solidarisierung der Bevölkerung mit den Hausbesetzern. Der Erfolg konnte von der Bewegung in der Folge durch eine steigende Anzahl von Mietstreiks und Hausbesetzungen genutzt werden. Der Frankfurter SPD-Magistrat konnte so zunächst dazu gezwungen werden, seine ursprüngliche Verfügung, alle besetzten Häuser sofort räumen zu lassen, zu revidieren.
Nachdem die Mietstreikbewegung der ausländischen Immigranten im Frühjahr 1973 zum Erliegen kam, konzentrierten sich die Diskussionen der Bewegung um die Verteidigung der besetzten Häuser und den militanten Schutz von Massendemos. Bei der drohenden Räumung des Kettenhofweges im Frühjahr 1973 beschlossen die Spontis, in die politische Offensive zu gehen. Darauf erfolgte ein brutaler und in der Öffentlichkeit als überhart empfundener Bulleneinsatz, der in der Frankfurter Innenstadt mehrere Straßenschlachten auslöste. Aufgrund der breit getragenen Solidarität und der Entschlossenheit zur militanten Verteidigung des besetzten Hauses im Kettenhofweg konnten mehrere Räumungsversuche der Bullen zunächst abgewehrt werden. In den Auseinandersetzungen drückte sich eine gelungene Verbindung von einer propagandistischen Massenarbeit mit einer Massenmilitanz aus, die sich nicht als Selbstzweck von den Inhalten des Kampfes ablöste. In der bürgerlichen Presse las sich das so:
»Inmitten der Großstädte entstehen Bürgerkriegsnester ... Es ist nicht auszuschließen, daß sich nach dem Frankfurter Beispiel inmitten der Großstädte eine Art Nebenregierung bildet, gestern Uni-Räte, heute die Häuserräte, morgen vielleicht die 'Räte der besetzten Fabriken'« (Frankfurter Neue Presse, April 1973).
Aufgrund der bei der Räumung des Kettenhofweges erlebten Bullenbrutalität konzentrierten sich die Überlegungen der Frankfurter Spontis in der Folgezeit auf die Organisierung eines militanten Schutzes von Massendemos. Es entstand die sogenannte »Putzgruppe«, die ein Ausdruck einer zu damaliger Zeit breit geführten Diskussion über die Probleme der Militanz und der organisierten Gegengewalt war. Die Debatte wurde dabei stets organisatorisch und politisch in die Bewegung zurückvermittelt, was vermutlich einer der Gründe dafür war, daß eine Kriminalisierung der Militanten zu jenem Zeitpunkt nicht stattfand.
Nach der Kettenhofweg-Räumung setzte allerdings auch eine weitgehende defensive Fixierung auf die Verteidigung des »Blocks« (Bockenheimer Landstr./Schumannstr.), auf Fragen der »militärischen Verteidigung« ein, die die Diskussionen um eine inhaltliche Ausweitung der Bewegung in den Hintergrund drängte. Zum Teil war das auf die praktische Erschöpfung vieler BewegungsaktivistInnen aufgrund der permanenten Repression zurückzuführen. Auf der anderen Seite schlugen in dieser Zeit bestimmte interne Führungsstrukturen des Revolutionären Kampfes auf den weiteren Kurs der Bewegung zurück. Der »Block« wurde schließlich von 2.500 Bullen Anfang Februar 1974 in einem Überraschungsüberfall geräumt und sofort durch Bagger in Schutt gelegt. Auch die am 23. Februar nachfolgende Putzdemo mit 10.000 Leuten, die zu den heftigsten Straßenschlachten in Frankfurt in den 70er Jahren führte, änderte an dem Erfolg des Frankfurter SPD-Magistrates nichts mehr.
Nach der Räumung des »Blocks« war die Bewegung in Frankfurt weitgehend am Ende. Die politische Orientierungslosigkeit nach dem Ende des Häuserkampfes wurde in einem rückblickenden Interview mit einem Spontigenossen wie folgt beschrieben:
»Da sind einfach die alten Machtstrukturen politisch umgeschlagen, und die Leute wußten nicht mehr, was sie machen sollten. Wenn du Leute teilweise von den politischen Entscheidungsstrukturen fernhältst, dann brauchst du dich hinterher nicht zu wundern, daß, wenn du nichts mehr vorgibst, auch nichts mehr nachkommt« (aus der »Wildcat« Nr. 40/1986).
 Über Militanzdebatten und andere Rückzüge
Über Militanzdebatten und andere Rückzüge
Nach dem Abflauen des Häuserkampfes versuchte die Spontibewegung, ihren Zusammenhalt und ihre politische Identität über den Aufbau eines »Gegenmilieus«, punktuelle Kampagnen und militante Aktionen aufrecht zu erhalten. (Sommer 1974 Fahrpreiskämpfe gegen den Frankfurter Verkehrsverbund; September 1975 Angriff auf das Spanische Generalkonsulat; im Mai 1976 militante Demonstrationen von 3.000 Leuten zum Tod von Ulrike Meinhof).
Die Entwicklung wurde zugleich mit einer Effektivierung der Straßenmilitanz in sogenannten »Kleingruppen« und teilweise klandestiner Organisierung verbunden. Zwar waren diese Kleingruppen zunächst in der Lage, den Bullen auf der Straße besser zu begegnen, allerdings setzte sich damit auch eine beschleunigte Zersplitterung der ehemals übergreifenden politischen Zusammenhänge durch.
Die innerhalb der Frankfurter Spontibewegung praktizierte unmittelbare Verknüpfung von Straßenmilitanz mit einer Vorstellung von Revolution wendete sich an dem Punkt gegen jede revolutionäre Vorstellung, als Formen von Straßenmilitanz unmittelbar nicht mehr praktizierbar waren und jeder abstrahierende Begriff von Revolution verloren ging.
Der in der Spontibewegung verfolgte politische Ansatz, ausgehend von den eigenen Bedürfnissen die politische Intervention zu bestimmen, greift zu kurz, wo schwierige gesellschaftliche Bedingungen (wie z.B. »Bewegungstäler« oder zu starke staatliche Repressionen) es notwendig werden lassen, von den eigenen Erfahrungen punktuell zu abstrahieren, um so nach anderen Möglichkeiten der politischen Arbeit zu suchen. Statt dessen kippte der Subjektivismus nach dem Ende des Häuserkampfes in die Illusion um, der Ablehnung der kapitalistischen Lohnarbeit die Fiktion einer sinnvollen selbstbestimmten Arbeit im Kapitalismus im Rahmen einer Alternativbewegung entgegensetzen zu können.
Die Hausbesetzung Eckhoffstr. 39 in Hamburg
Ausgangspunkt der Hausbesetzung in der Eckhoffstraße waren die Pläne der Neuen Heimat-Tochtergesellschaft Bewobau, große Teile des innenstadtnahen Viertels Hohenfelde abzureißen, um dort 19stöckige Wohntürme mit insgesamt 450 Luxuseigentumswohnungen zu errichten. Die Entwicklung zog sich über mehrere Jahre hin und wurde durch eine gezielte Vertreibung von alteingesessenen MieterInnen begleitet. Die Umstrukturierung der Bewohnerschaft wurde zudem noch durch die vorübergehende Einquartierung von mobilen Studenten mit kurzfristigen Mietverträgen vorangetrieben. Zum Zeitpunkt der Besetzung standen deshalb viele Häuser im Viertel leer oder waren an Studenten vermietet, von denen die Behörden annahmen, daß sie an einer längerfristigen Nutzung kein Interesse hatten. Den Praktiken der Neuen Heimat schlossen sich ebenfalls noch private Spekulanten an. Die gegen die verbliebenen Mieter angewendeten brutalen Methoden führten zunächst zu der Gründung einer Mieterinitiative, die mit Mitteln wie z.B. Unterschriftenlisten, Flugblättern und offenen Briefen jedoch kaum etwas bewirken konnte. In diese Situation fiel die Besetzung der Eckhoffstr. 39 am 19. April 1973.
»Sie war der Versuch einer Fraktion der Hamburger Linken, der 'Spontis', bestimmte politische Vorstellungen, die monatelang in kleinen Gruppen diskutiert worden waren, endlich praktisch werden zu lassen. Die Aufrüstung des westdeutschen Polizeiapparates und die im Zuge der Baader-Meinhof-Kampagne sich verschärfende Repression gegen die Linke hatten in diesen Gruppen vor allem zu einer intensiven Diskussion der Frage der revolutionären Gewalt geführt. Der Frankfurter Häuserkampf, der wenige Tage zuvor einen Höhepunkt in den Auseinandersetzungen um das besetzte Haus am Kettenhofweg 51 erreicht hatte, schien ein Beispiel geliefert zu haben, daß sich eine Mobilisierung von größeren Teilen der Bevölkerung durchaus mit radikalen und kompromißlosen Formen des politischen Kampfes verbinden läßt. Die Vorbereitung auf eine nach allen Erfahrungen zu erwartende Konfrontation mit dem staatlichen Repressionsapparat spielte deshalb bei der Vorbereitung der Besetzung und im Auftreten ihrer Akteure (Helm, Gesichtstücher, Schlagstöcke) eine große Rolle« (Grüttner).
Zu Beginn der Eckhoffstraßenbesetzung entwickelte sich in dem Viertel eine Solidarität, die von Möbelspenden bis zu Solidaritätstransparenten an anderen Häusern reichten. Die Besetzer nahmen zunächst Kontakt mit den MieterInnen der umliegenden Häuserblocks auf, organisierten Versammlungen, auf denen sie ihre Vorstellungen zusammen mit den Anwohnern diskutierten und richteten im Haus ein Stadtteilbüro sowie ein Jugendzentrum ein. Das Haus wurde insbesondere für Jugendliche in dem Stadtteil zu einem ständigen Bezugspunkt.
Diese Initiativen, die Unterstützung, die die Besetzer in der Öffentlichkeit fanden, und ihre erklärte Absicht, das Haus militant zu verteidigen, machten es dem Hamburger SPD-Senat, der Bewobau und den Bullen zunächst unmöglich, das Haus im Handstreich zu räumen. Sie verlegten sich deshalb zunächst auf eine politische Isolierung der Besetzer sowie deren Kriminalisierung. Der eine Teil dieses Konzeptes wurde von der Hamburger Springerpresse besorgt, die die Hausbesetzer permanent als »Reisende Radikale«, »Maskenmänner«, »Politrocker«, »Terroristen« und »Gangster« bezeichnete. Zu dieser Propaganda gehörten natürlich auch erfundene Geschichten über vermeintliche Überfälle der Hausbesetzer auf BewohnerInnen im Viertel. Den anderen Teil des Konzeptes besorgten die Bullen mit permanenten Provokationen. Sie zielten durch ständige Übergriffe und die Behinderung aller Besetzeraktivitäten darauf ab, deren Handlungsspielraum möglichst einzuengen. Sämtliche Besetzer, Sympathisanten oder Anwohner, die sich in der Eckhoffstraße aufhielten, wurden an der nächsten Straßenecke angehalten, überprüft und zum Teil in das Polizeipräsidium geschleppt und erkennungsdienstlich behandelt. Die Besetzer versuchten sich gegen diese Schikanen durch organisiertes militantes Auftreten zur Wehr zu setzen und ließen sich dabei auf einen Kleinkrieg mit den Bullen ein, dem sie aber auf Dauer nicht gewachsen waren. Dabei traten andere politische Aktivitäten in den Hintergrund und erlahmten schließlich völlig. Die militärische Konfrontation mit den Bullen begann sich im Laufe der Besetzung zu verselbständigen. Mit der Verlagerung der Besetzeraktivitäten von der politischen auf die militärische Ebene verringerte sich zugleich die Solidarität der Bevölkerung, die durch den ständigen polizeilichen Belagerungszustand in Auseinandersetzungen mithereingezogen wurde.
Am 23. Mai 1973 wurde die Eckhoffstraße in den Morgenstunden von 600 Bullen abgeriegelt und von einem mit Maschinengewehren bewaffneten MEK-Kommando überfallen. Über 70 BesetzerInnen wurden festgenommen, gegen 33 von ihnen wurden erstmals in der BRD Haftbefehle unter dem Vorwurf der »Mitgliedschaft oder Unterstützung in einer kriminellen Vereinigung« (§ 129) erlassen, der später auch zu einer Reihe von Verurteilungen führte.
Die Ereignisse um die Eckhoffstraßenbesetzung wurden für die Hamburger Spontilinke zu einem wichtigen Schnittpunkt ihrer weiteren politischen Aktivitäten: mit der polizeilichen Zerschlagung der Besetzung scheiterte zugleich auch die »Proletarische Front« als Organisation. Sie hatte die Hausbesetzung unterstützt, obwohl sie zuvor auf Grundlage ihrer eigenen Diskussionen den Häuserkampf nur in Arbeitervierteln, bei genügender propagandistischer Vorbereitung nach außen, tragen wollte. Diese Bedingungen waren jedoch für die Eckhoffstraßenbesetzung nicht gegeben, da der Stadtteil zuvor bereits weitgehend von seinen Bewohnern geräumt worden war. Damit waren die Möglichkeiten, das Haus zum Ausgangspunkt weiterer Aktivitäten im Stadtteilkampf in Hohenfelde zu machen, stark begrenzt. Zudem eskalierte für die »Proletarische Front« während der Besetzung das »Militanzproblem«, das zu einer Frage der individuellen moralischen Bewährung oder des Versagens der einzelnen GenossInnen wurde und an dem sich die Gruppe schließlich aufrieb.
Einige EckhoffstraßenbesetzerInnen entschlossen sich unter dem Eindruck der Räumung und der gegen sie durchgeführten staatlichen Repressionsmaßnahmen dazu, in den Untergrund zu gehen. Zwei von den Genossen (Karl-Heinz Dellwo und Bernhard Rößner) gehörten im Februar 1975 zu einem RAF-Kommando, das mit dem Überfall auf die deutsche Botschaft in Stockholm die Freilassung der Stammheimer RAF-Häftlinge durchzusetzen versuchte. Die Beteiligung von ehemaligen Hausbesetzern an der Aktion einer bewaffnet kämpfenden Gruppe diente in der Folge staatlichen Instanzen dazu, die Kampfform Hausbesetzungen beständig als eine »Durchgangsstation« für »Terroristen« zu denunzieren. Unter dem Eindruck des »Traumas« der Eckhoffstraßenbesetzung verlor die Hamburger Spontilinke für mehrere Jahre die Kraft zu größeren politischen Initiativen. Diese Situation änderte sich erst wieder ab 1976 in dem Kampf gegen das geplante AKW in Brokdorf.
Die Spontibewegung an den Universitäten
Die Situation der Studenten an den Universitäten hatte sich in der ersten Hälfte der 70er Jahre gegenüber den 60er Jahren stark verändert: Durch technokratische »Bildungsreformen« wurde die Uni zur Massenuniversität; die Anzahl der Studenten in der BRD und West-Berlin von 1960 bis 1979 verdreieinhalbfachte sich auf knapp eine Million. Auf der politischen Seite war die Situation, insbesondere in einigen »linken Fachbereichen«, durch eine »Wissenschaftsblüte« und die politisch dominierenden maoistischen ML-Organisationen oder links-reformistischen Studentengruppen gekennzeichnet. Während die »Parteiaufbauer« die Notwendigkeit der Unterordnung von »individuellen Bedürfnissen« unter die »Erfordernisse des Klassenkampfs« propagierten, setzten viele durch die 68er Revolte in akademische Stellen gespülte »linke Wissenschaftler« mit enormen Leistungsansprüchen alles daran, die »bürgerliche Wissenschaft« zu entlarven. Sie konnten dabei ihre universitäre Praxis in dem Abfassen von dickleibigen Doktorarbeiten nicht nur mit ihrer eigenen beruflichen Karriere, sondern auch mit der Illusion eines gleichzeitigen politischen Fortschrittes für die Linke verbinden.
»In dieses Klima ... gerieten während der letzten zwei Drittel der 70er Jahre Studenten, die da nicht 'mithalten' konnten und wollten. Sie konnten es nicht, weil ihnen ... die Motivation, der große Impuls von '68 fehlte; und sie wollten es nicht, weil ihnen der Preis (Arbeitseinsatz, politische Risiken) zu hoch schien im Vergleich zu dem vielleicht möglichen, aber immer ungewisser werdenden Resultat. Hinzu kamen ... die Verschlechterung der Berufsaussichten und die 'empirische' Widerlegung traditioneller und neuerer politischer Hoffnungen, von einer möglichen Zuspitzung der Klassenkämpfe bis zur 'persönlichen Emanzipation', die als Zielpunkte am Horizont aufblitzten und wieder verblaßten« (Schütte).
Die erklärtermaßen theorie- und wissenschaftsfeindlichen Spontigruppen erlebten ihren politischen Aufstieg an den Universitäten Mitte der 70er Jahre. Mit unkonventionellen, witzigen und phantasievollen Aktionen versuchten sie, sich gegen den Universitätsbetrieb zur Wehr zu setzen: So wurde z.B. im Jahre 1978 auf Vorschlag von Sponti-Studenten in Münster ein Schwein zum Rektor der Universität gewählt. In Ulm ließen sie im gleichen Jahr stellvertretend für sich einen Hund zum akademischen Senat kandidieren. Auf ihrem Höhepunkt in den Jahren '77/'78 stellten die Spontis in einer Reihe von Universitätsstädten die Studentenvertretungen.
Die Spontibewegung in den 70er Jahren beinhaltete ein reiches, in sich widersprüchliches Ausdruckspotential von verschiedenen Protest-, Auflehnungs-, Verweigerungs- und Fluchtverhalten gegen bürgerliche Herrschaftsnormen. Auf der politischen Ebene dominierten antiinstitutionelle, basisdemokratische, autonomistische und anarchistische Elemente ihre Vorstellungen. Ihr Protest richtete sich gleichermaßen gegen die »Wissenschaftsfabrik Uni« und gegen die staatliche Repression.
Nach den desillusionierenden Erfahrungen mit den »Reformunis« verlagerten viele Spontis im letzten Drittel der 70er Jahre zunehmend Teile ihrer Praxis in Alternativprojekte, Stadtteil- und Anti-AKW-Gruppen. Die Massenuniversitäten wurden dabei bis heute! zu einem relativen »Freiraum«, der die Möglichkeit für ein politisches Engagement an anderen Stellen bot.
Die Spontibewegung wäre jedoch nur unvollständig beschrieben, wenn nicht auch ihre sozialpsychologischen Dimensionen genannt würden: In einer abstrakten Beschreibung läßt sich das als Versuch eines Aufbaus von harmoniefähigen Erfahrungszusammenhängen benennen, der in einem untrennbaren Zusammenhang mit einer spekulativen Suche nach einem unbestimmten Anderen stand. Etwas konkreter ist darunter zu verstehen, daß mehr als einmal Spontigruppen mit ihren teilweise aberwitzig hohen und nicht selten diffusen Gruppenansprüchen im unpolitischen Psycho-Desaster endeten. Oft verband sich in der Bewegung eine »Betroffenheitsideologie« mit Tendenzen zu einer »neuen Innerlichkeit«, die teilweise zu unpolitischen und resignativen Rückzügen in Wohngemeinschaften, Therapiegruppen und selbstzerstörerischen Drogenkonsum führte. Die Erfahrungen aus der Zeit machen deutlich, daß der in der Spontibewegung auch enthaltene Anspruch einer »Befreiung von Politik« oft in ein unpolitisches und privatistisches Selbstverständnis umschlagen kann.
Kurze Geschichte der K-Gruppen und ihres Zerfalls
Bereits in der APO-Zerfallsphase hatte es innerhalb der Bewegung gravierende Kontroversen um die von Teilen des SDS betriebenen Marxistisch-Leninistischen(ML)-Parteigründungskonzepte gegeben. Auf die Frage nach den Perspektiven der weiteren politischen Arbeit antwortete ein Teil der antiautoritären Bewegung mit einem Dogmatisierungsprozeß. Dabei entstand auch die Parole »Liquidiert die antiautoritäre Phase«, die für einen großen Teil der studentischen Basis die Grundlage für eine sogenannte »proletarische Wende« bildete. Auf das eigene unbegriffene »antiautoritäre Ausflippen« in der Studentenrevolte erfolgte mit dem biographischen Hintergrund einer zumeist mittelständischen Sozialisation die Rückkehr in die überschaubare »kleinbürgerliche Struktur« einer ML-Kaderpartei. Dies war zumeist mit einer irrationalen Unterwürfigkeit und dem Verzicht auf eigenes Denken verbunden. Die vormals proklamierte »revolutionäre Identität« des Individuums wurde auf eine Organisation verlagert, die sich zur jeweils »führenden Partei des Proletariats« ernannte.
Aus den diversen Parteigründungskonzepten bildeten sich vier größere K-Gruppen-Zusammenhänge heraus. Dabei setzte sich in einigen Städten und Regionen jeweils eine ML-Organisation durch.
In West-Berlin dominierte die KPD-Aufbauorganisation (KPD-AO), die sich im März 1980 auflöste. Demgegenüber spielte die von alten KPD-Mitgliedern bereits Ende 1968 gegründete KPD-ML vorwiegend in Kiel und im Ruhrgebiet eine Rolle, während in Hamburg der 1971 gegründete Kommunistische Bund bis zu einer Spaltung Ende der 70er Jahre als ML-Organisation führend war. Als letzte größere ML-Organisation wurde schließlich im Jahre 1973 aus einer Reihe von zuvor existierenden Diskussionszirkeln der Kommunistische Bund Westdeutschlands (KBW) gegründet. Er spielte in den 70er Jahren zeitweise in Frankfurt, Heidelberg und Bremen eine größere Rolle, bevor er sich im Jahre 1982 auflöste.
Verbindendes Glied dieser ML-Gruppierungen waren, neben ihrer Fixierung auf die revolutionäre Rolle des Fabrikarbeiterproletariats, ihre auf Mao-Ideologeme gestützte »antirevisionistische« Einstellung gegenüber der DKP und der Sowjetunion. Auf der programmatischen Ebene schlug sich das in einer rigorosen außenpolitischen Orientierung an der Politik der VR China, ergänzend an Albanien, nieder. Diese politische Linie verband sich mit einer mehr oder weniger großen Distanz zur Sowjetunion bzw. zum »real existierenden Sozialismus«. Die ablehnende Haltung zur SU steigerte sich bei einigen ML-Gruppen bis zum Vorwurf des »Sozialimperialismus«. Dies führte dazu, die UdSSR als den im Vergleich zur USA größeren Hauptfeind einer revolutionären-sozialistischen Entwicklung anzusehen. Teilweise kam es in diesem Kontext zu Forderungen wie z.B. der der KPD-ML nach einem, gegen die »sozialimperialistische UdSSR«, wiedervereinigten »sozialistischen deutschen Vaterland«.
Viel verheerender als alle programmatischen Verwirrungen der ML-Gruppen auf dem Sektor der Außenpolitik waren jedoch ein schematisiertes Theorie-Praxis-Verständnis und ihre organisatorischen Binnenstrukturen: Ihr autoritäres und dogmatisches Theorieverständnis auf proklamierter Grundlage der Theorien des Marxismus-Leninismus strich den universellen Horizont dieser Theorien mit Hilfe von dürren politökonomischen Lehrsätzen zu einem kleinkarierten vulgärmarxistischen Schrebergartensystem zusammen. Die »führende Rolle der Partei des Proletariats« wurde zunächst einmal gegenüber den eigenen Mitgliedern durchgesetzt. Die vorgeblich an den Prinzipien des Marxismus-Leninismus angelehnten Organisationsstrukturen führten nicht nur zu einer straffen von oben nach unten aufgebauten hierarchischen Leitungsstruktur, sondern auch zu einer zunehmend sinnentleerten, kritiklosen Anwendung von Gehorsam, Disziplin und einer wahnwitzigen Durchhaltemoral in der politischen Arbeit. Wie selbstverständlich wurden von den einzelnen Mitgliedern anachronistische Leistungsstandards in der politischen Arbeit verlangt. Die sozialen Beziehungen und Alltagsstrukturen der Mitglieder wurden bis in die intimsten Bereiche entschieden und geregelt. In diesem Zusammenhang wurden weite Teile des privaten Einkommens an die Organisation abgeführt, »Rote Ehen« geschlossen, die Haare kurzgeschnitten und teilweise 18 Stunden am Tag »revolutionäre Parteipolitik« gemacht. Demgegenüber wurden die Politikformen und Muster der damaligen Linksradikalen aus der Spontiszene von den ML-Gruppierungen als »elitär« und »kleinbürgerlich« denunziert.
Mitte der 70er Jahre stellten die K-Gruppen in einigen Großstädten in einer formalen Betrachtungsweise die stärkste außerparlamentarische Kraft der Linken dar. Zeitweise waren in diesen Gruppen weit über 10.000 Menschen organisiert, der KBW brachte es als größte ML-Organisation auf über 3.000 Mitglieder, der KB in Hamburg verfügte im Jahr 1978 über 900 Aktivisten. Im Jahr 1977 wurden von dem KBW-Organ »Kommunistische Volkszeitung« wöchentlich über 30.000 Exemplare verkauft, und auch der »Arbeiterkampf« des KB konnte in dieser Zeit mit einer wöchentlich vertriebenen Auflage von über 25.000 Exemplaren mithalten.
Hin und wieder blitzte auch bei den ML-Organisationen ein erstaunliches Maß an Militanz auf: So stürmten Mitglieder der KPD im April des Jahres 1973 im Anschluß an eine Demonstration gegen den Besuch des südvietnamesischen Ministerpräsidenten in Bonn das dortige Rathaus und zerlegten die Inneneinrichtung. In den Jahren 1975/76 wurden vom KBW in Heidelberg und Bremen massive Straßenbahnblockaden gegen die Erhöhung der Fahrpreise organisiert. Zu Beginn der bundesweiten Anti-AKW-Bewegung stellten die K-Gruppen große Kontingente hervorragend ausgerüsteter Genossen, die sich massiv an den praktischen Auseinandersetzungen beteiligten. Das führte nach der Grohnde-Demonstration im März 1977 seitens der Herrschenden zu einer intensiven Verbotsdiskussion, insbesondere gegen den KBW. Dagegen mobilisierten alle K-Gruppen (mit Ausnahme des KB) im Oktober '77 zu einer Großdemonstration rund 20.000 Menschen auf den Bonner Marktplatz, der von einem Meer von roten Fahnen eingenommen wurde ...
Der Zerfall der K-Gruppen setzte Ende der 70er Jahre ein: Der Rückgriff auf Parteikonzeptionen aus den 20er Jahren und das Festhalten an einem völlig anachronistischen und rückwärtsgewandten Proletariatsbegriff, der sich an dem männlichen Fabrikarbeiter orientierte, erwies sich unter den spätkapitalistischen Bedingungen der BRD als eine revolutionsstrategische Lachnummer. Zudem ließen sich die mit dem Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen (Anti-AKW-, Ökologie- und Alternativbewegung) und die in der Patriarchatsdebatte neu entstandenen Fragestellungen auf Grundlage eines starr angewendeten ML-Theoriesystems nicht mehr beantworten. Auch vor diesem Hintergrund waren viele Mitglieder dieser Organisation nicht mehr dafür zu mobilisieren, sich bis in den Bereich ihrer privaten Sphäre hinein totalisierenden Politikmustern zu unterwerfen.
Sofern sich die Kader der ML-Gruppierungen nach dem Zerfall ihrer Organisationen nicht privatisierten, lösten sie sich in den Gründungsprozeß der Grünen Partei auf. So trieben z.B. in der West-Berliner AL bis in die späten 80er Jahre ein paar alte KPD-AO-Mitglieder mit ihrer alten Forderung nach einer »Wiedervereinigung eines von den Supermächten befreiten einigen deutschen Vaterlandes« ihr Unwesen. Mittlerweile werden eine Reihe von mittleren und höheren Funktionärsposten bei den Grünen von ehemaligen MLern bekleidet, die dort ihre »revolutionären Jugendsünden«, wie z.B. die Ex-KPD Sympathisantin Antje Vollmer und der Ex-KBWler Fücks, mit geläuterten Bekenntnissen zum »demokratischen Rechtsstaat« abzutragen suchen.
Von der Krise und dem Zerfall der ML-Bewegung wurde auch der Hamburger KB um die Jahreswende 1979/80 getroffen. Bei dem Versuch zunächst relativ flexibel auf den Parteibildungsprozeß der reformistischen grünen Partei Einfluß zu nehmen, spaltete er sich in einen bei den Grünen mitarbeitenden und in einen weiterhin sich als kommunistische Organisation begreifenden Flügel.
Ende der 80er Jahre existierten nur noch Reste der ehemaligen K-Gruppen in Verbänden wie z.B. BWK, VSP, MLPD usw. Sie waren jedoch nicht mehr eigenständig zur Organisierung von größeren Straßenaktionen in der Lage. Dennoch spielten da und dort die alten ML-Ideologien der 70er Jahre für die autonom-linksradikale Szenerie der 80er Jahre eine nicht immer angenehme Rolle.
 Die Alternativbewegung
Die Alternativbewegung
Der Beginn der Alternativbewegung in der BRD und West-Berlin läßt sich im wesentlichen mit zwei Entwicklungslinien in Verbindung bringen: Auf der politischen Seite war die Situation Mitte der 70er Jahre von einer Desorientierung gekennzeichnet, die mit einer Abwendung von einer auf die Betriebe oder sonstige politische Initiativen zentrierten Politik einherging. Die Alternativbewegung schien einen Ausweg aus der Schere zwischen staatlicher Repression und Integration zu eröffnen. Dabei konnten sich weite Teile der Spontiszene in einem historischen Rückgriff an den bereits während der APO-Zeit in ihrer antiautoritären Phase formulierten Ansprüchen orientieren, die politische Arbeit mit individueller und kollektiver Emanzipation zu verbinden. Die objektiven und subjektiven Schwierigkeiten einer solchen Verbindung und die Erfahrung der enormen Stabilität des bundesdeutschen Herrschaftssystems (vor allem nach dem Amtsantritt der SPD/FDP-»Reformregierung« im Jahre 1969) führten jedoch dazu, daß viele der politisierten StudentInnen sich anderen Formen der politischen Arbeit zuwandten. Es begann die Zeit der ML-Gruppen oder der stringent marxistisch-operaistischen Ansätze.
Als ab 1974 sichtbar wurde, daß ein autoritäres politisches Praxisverständnis in die Isolierung führte, sahen viele kaum noch eine Möglichkeit für eine organisierte politische Arbeit.
Daraus entstand so etwas wie eine »Nebenbewegung«, die versuchte, eine praktische Alternativgesellschaft aufzubauen. Die Bewegung breitete sich dort am stärksten aus, wo zuvor auch intensive, von Linksradikalen getragene Konflikte stattgefunden hatten. West-Berlin und Frankfurt wurden zu Schwerpunkten der bundesdeutschen Alternativbewegung.
Viele der alternativen Projekte begriffen sich zu Beginn als eine notwendige Unterstützung der Bewegung im politischen Tageskampf (linke Buchläden, Kneipen, Cafés, Druckereien usw.). Darüber hinaus waren die Projekte mit einer »sozialutopischen« Stoßrichtung verknüpft, in denen sie eine Art praktisches Beispiel für eine Vorwegnahme sozialistischer Strukturen im Kapitalismus sein sollten. In der Praxis ging es darum, eine gelebte Alternative zu den herrschenden kapitalistischen Verkehrsformen darzustellen, was zugleich einen propagandistischen Effekt zeitigen sollte. Damit ist der Beginn der Alternativbewegung nicht zu trennen von den autonomistischen Impulsen des Widerstands und der Ablehnung der kapitalistischen Lohnarbeit, die im Alltag sichtbar demonstriert werden sollte. Und so entstand nach dem Ende des »Wir wollen alles«-Zeitungsprojektes der operaistischen Gruppen im Spätsommer 1975 mit einem fast identischen Titel-Layout das Zeitungsprojekt »Wir wollen's anders« von der Arbeiterselbsthilfe Oberursel.
Der weitere Verlauf der Alternativbewegung vollzog sich jedoch unter den »objektiven Bedingungen« von ökonomischen Krisenprozessen. Das führte auf der ökonomischen Basis einer in den Alternativbetrieben vorherrschenden kleinen Warenproduktion und -verteilung zu einer ganzen Reihe problematischer und widersprüchlicher Tendenzen. Auf der ideologischen Ebene wurde z.B. der ursprünglich einmal proklamierte Auszug aus entfremdeten und repressiven normalgesellschaftlichen Strukturen teilweise zu einer individualistisch-selbstgefälligen Selbstmarginalisierung verabsolutiert. Die Probleme und ideologischen Verirrungen lassen sich in einer Beschreibung anhand der Begriffe »Alternativökonomie« und »Alternativideologie« darstellen:
Die Alternativbewegung entpolitisierte sich in dem Maße, in dem mit Hilfe einer von ihr produzierten »Alternativideologie« die Banalität ihrer ökonomischen Tätigkeiten ideologisiert wurde. Dieser Prozeß konnte zunehmend als verkaufsförderndes Mittel von in unterkapitalisierten Betrieben hergestellten Produkten eingesetzt werden. Der Begriff der »Alternativökonomie« wirkte sozusagen als ein Mittel betriebswirtschaftlicher Rationalität, die gezielt im kapitalistischen Markt der Produkte eingesetzt wurde. Mit einem überteuerten Bioapfel oder einer biodynamisch verkleideten Futtermöhre aus einem Alternativprojekt wurde die »Gesundheitsideologie« gleich mitbezahlt. Bereits im Entstehen der Alternativbewegung war somit eine Tendenz des Übermächtigwerdens von ökonomischen Sachzwängen über das Bewußtsein der in der Bewegung tätigen Individuen angelegt. Das hat in der weiteren Entwicklung bis zum Ende der 80er Jahre seinen Ausdruck in der weitgehenden Integration vieler ehemaliger Alternativbetriebe in das kapitalistische Marktgeschehen gefunden.
Ökonomischer Krisendruck im Zusammenspiel mit der innovativen Integration bestimmter, ursprünglich gegenkultureller Ansätze der Alternativbewegung sorgten dafür, daß viele ihrer ehemaligen Aktivisten mittlerweile auf den Interessenshorizont eines »alternativen Kleinunternehmers« herabgesunken sind. Hinter dem Rücken von vielen AkteurInnen haben sich in diesem Prozeß der gesellschaftlichen Reintegration die kapitalistischen Leistungsnormen und Prinzipien wieder erneuert.
In autonomen Kreisen gehört es zum guten Ton, eine scharfe und grundsätzliche Kritik an den mit der Alternativbewegung verknüpften Illusionen zu üben. Die Entwicklung der Alternativbewegung zeige, daß die Kritik an bestimmten Lebensformen immer integrierbar sei und verquere Form annehme, solange sie sich nicht mit dem Kampf gegen die Verhältnisse verbinde, die sie produzieren würden. Die Alternativbewegung sei für das Kapital total produktiv gewesen, da sie die ganzen rebellischen Elemente aus den Fabriken und von der Straße weggeholt und mit dem Aufbau eines Ghettos beschäftigt habe. Zudem habe sie der Ausbeutung durch das Kapital die ideologisch verschleierte Selbstausbeutung hinzugefügt (vgl. hierzu: »Wildcat« Nr. 40/ 1986).
Diese nachträglich geäußerte Kritik bleibt jedoch in gewisser Weise »objektivistisch« und der historischen Situation Mitte der 70er Jahre aufgesetzt. Zudem ist sie mit Verallgemeinerungen gegenüber einem »Gegenstand« verbunden, der selber in sich widersprüchlich ist: Noch immer existieren alternative Projekte, die nach wie vor auf den Prinzipien der Autonomie, der Selbstorganisation, der authentischen Artikulation von Bedürfnissen und Interessen basieren. Sie begreifen sich als Provisorium gegenkultureller Lebensformen, die die Basis dafür bilden, sich der kapitalistischen Leistungsgesellschaft zu verweigern.
»Die letzten Dinge eines jeden ernsthaften Sozialrevolutionärs: gemeinschaftliches Eigentum, egalitäre hohe Einkommen bei möglichst wenig notwendiger Arbeit und möglichst viel selbstbestimmter Tätigkeit, Aufhebung des Geschlechterwiderspruchs, Auflösung der Kernfamilie, dezentrale Selbstbestimmung unter Ausschaltung jeder Art von Bürokratie und Staat, alternative Technologie und dadurch Rekonstruktion der natürlichen Umwelt, sind sicher nur in Keimform heute vorwegnehmbar. Und dennoch bin ich davon überzeugt, daß die ersten direkten Schritte darauf so ungeheuer wichtig sind, weil sie einen neuen Anfang darstellen. Einen Anfang zu neuen Hoffnungen, nämlich dazu, daß sich die Kluft zwischen den unmittelbar möglichen Ansätzen zu sozialer Selbstverwirklichung und dem gesamtgesellschaftlichen Ziel eines Tages doch als überbrückbar erweisen wird« (K.H. Roth).
Gerade diese in einigen Projekten vorhandenen Ansprüche machen es vielen Linksradikalen in den Großstädten immer noch möglich, sich dort relativ frei und eingebettet in solidarischen Kommunikationsstrukturen zu bewegen. So wurden zwar während der West-Berliner Hausbesetzerbewegung Anfang der 80er Jahre von Autonomen bestimmte Formen der Alternativbewegung scharf kritisiert, die sie jedoch zugleich zu der eigenen »ökonomischen Basis« des Kampfes erklärten (siehe hierzu auch das Kapitel über die Autonomievorstellungen im West-Berliner Häuserkampf). Nach wie vor existieren noch Teile von Alternativprojekten als Absprungbrett für den politischen Kampf der darin tätigen GenossInnen. Deshalb geht auch jede pauschalisierende Kritik an den Projekten an einer Bewegung vorbei, die ohnehin aufgrund der Systemintegration Ende der 80er Jahre ihre ursprünglich einmal gemeinsamen Konturen verloren hat.
Das Zeitschriftenprojekt Autonomie
Ab Oktober 1975 erschien die Zeitschrift Autonomie mit dem programmatischen Untertitel »Materialien gegen die Fabrikgesellschaft«. Das Projekt entstand aus dem Zerfall der »Wir wollen alles«-Gruppen, deren Zeitung im Sommer des gleichen Jahres ihr Ende gefunden hatte. Die Autonomie kann als eine Art Theorieorgan der WWA-Gruppen zu einem Zeitpunkt begriffen werden, als diese sich in einer Phase der Neuorientierung befanden.
Die Zeitschrift existierte mit einem wesentlichen Bruch um die Jahreswende '78/'79 bis 1985. Bis Ende des Jahres 1978 wurde die Redaktion sowohl von einer Frankfurter als auch von einer Hamburger Gruppe besorgt. Nach dem Bruch wurde sie als »Neue Folge« allein von den Hamburgern bis zu ihrer Einstellung 1985 fortgeführt.
Im Gegensatz zur »Neuen Folge«, die stets als thematische Schwerpunkthefte konzipiert wurde, machte die Autonomie bis 1979 in ihren Beiträgen die schillernden Facetten dieses Begriffes deutlich. Dabei wurde die starke Unterschiedlichkeit der verschiedensten Diskussionsansätze deutlich:
»Da finden sich Auseinandersetzungen mit der theoretischen Position des Operaismus ebenso wie die eigenen Betriebserfahrungen. In der Autonomie werden aber auch Brüche mit der eigenen Vergangenheit deutlich: So beispielsweise die Rezension von Thomas Schmid über Glucksmann 'Köchin und Menschenfresser' oder J. Fischers Aufsatz anläßlich der Demonstration zum Tod von Ulrike Meinhof. Neben historischen Analysen wie 'Taylor in Rußland'; 'Lebensmittelunruhen in Bremen 1920' oder 'Gebärstreikdebatte vor dem Ersten Weltkrieg' wurden Aufsätze zur aktuellen gesellschaftlichen Realität, Arbeitslosigkeit und Krise publiziert. Stärker vertreten sind jedoch die Themen, die sich die politische Bewegung selbst stellte: Regionalismus, Alternativbewegung und Gegenökonomie. Ökologische Fragestellungen und Untersuchungen finden sich in den ersten Heften nur begrenzt. Durchgängig ist jedoch die Beschäftigung mit dem Thema Knast, sei es, daß über politische Prozesse informiert wird oder Gefangene zu Wort kommen« (Ebbinghaus).
Aus Frankfurter Sicht kam diese Zeitschrift in eine Situation, wo antiautoritäre Organisationsformen von Parteiplänen bedroht wurden. Zudem schien die zuvor propagierte Betriebsarbeit nur dem Reformismus zu dienen, und darüber hinaus ließ die aufkommende Anti-AKW-Bewegung die proletarische Orientierung fragwürdig werden. Demgegenüber hielten die Hamburger in ihren Beiträgen an einer marxistisch-operaistischen Orientierung fest.
So fanden sich unter dem Oberbegriff »Autonomie« zunächst zwei völlig unterschiedliche und dann zunehmend entgegengesetzte Orientierungen. Dem eher subjektivistisch-ästhetischen Ansatz der »Frankfurter« stand der eher analytisch kompromißlose revolutionäre Ansatz der »Hamburger« gegenüber. Aufgrund dieser Differenzen kam es nach dem Heft 12 im Dezember 1978 zwischen beiden Redaktionsgruppen zur Spaltung. Dazu schreiben die »Hamburger«:
»Die 'Autonomie' entstand einmal in dem Moment, als die linksradikalen Gruppen, die sich als Versuch der organisierten Fortsetzung und Umwandlung der sozialrevolutionären Bewegung gegen Ende der 60er Jahre verstanden, auseinanderfielen. Die Entdeckung der Vielfalt, die die 'Autonomie' von Anfang an kennzeichnete, war nicht gedacht als Aufgabe des revolutionären Impulses. Ausgangspunkt war damals vor etwa drei Jahren die Einsicht, daß die Gruppen nicht nur an der repressiven Realität der BRD zerschellt waren, daß sie vielmehr auch keine angemessene, weil beschränkte und ärmliche Antwort auf den umfassenden Prozeß sozialer Neuzusammensetzung waren. So waren die Diskussionen um die Community, den Regionalismus und die Mikrophysik der Macht und anderes erste tastende Versuche, uns von den theoretischen und politischen Versteinerungen, die wir '68 ff erlebt und mitgetragen haben, wieder freizuschaufeln und uns an ein Verständnis der modernen Klassenrealität und ihrer noch gänzlich unerforschten Geschichte heranzutasten.
Später kam es anders, die Vielfalt nahm selbstgenügsame Züge an, sie wurde zum gepflegten Pluralismus. Wo eine aktuelle revolutionäre Perspektive nötig gewesen wäre und die Vielfalt hätte in sie einfließen müssen, bewirkte der selbstgenügsame Umgang mit den einzelnen Bausteinen dieser Vielfalt etwas anderes: es entstand eine Ideologie hart an der Grenze der Philosophie der Bewegungslosigkeit der neuentdeckte Reichtum (der freilich weit ärmer ist als er tut) machte den Gegner und auch die Frage der Macht vergessen. Die 'Autonomie' hatte an diesem Prozeß teil. Ihr Fehler war es, daß sie gegenüber dem Prozeß der (sicher nur teils selbst gewählten) Abschottung der linksradikalen und alternativen szene blind war, daß es sie nur wenig interessierte, daß hier eine sozialrevolutionäre Bewegung ins Ghetto und die Nutzbarmachung abgedrängt wird.«
Die Hamburger Redaktionsgruppe reflektierte mit diesen Bemerkungen den Prozeß der schleichenden Abkehr ehemals linksradikaler GenossInnen von revolutionären Standpunkten unter dem weiten Deckmantel des »Autonomie«-Begriffs. Der Vorwurf erwies sich im nachhinein als nicht unberechtigt: Ehemalige Frankfurter Spontis bestimmten seit Anfang der 80er Jahre als Exponenten des sogenannten realpolitischen Flügels maßgeblich den Kurs der Grünen. Der ehemalige Autonomie-Autor Thomas Schmid galt in den 80er Jahren als »Vordenker« der am rechten Rand der Grünen Partei angesiedelten sogenannten »öko-libertären« Strömung, die mit Hilfe des gezielten Mißbrauchs des Begriffs »libertär« einen antisozialistischen Bogen von den Grünen zu F.D.P. und CDU-Modernisierungspolitikern zu schlagen versuchte.
Während die Frankfurter Redaktion nach diesem Bruch nur noch zwei Hefte (über »Neue Medien« und die »ästhetische Faszination am Faschismus«) produzierte und danach aufgab, setzten die Hamburger das Autonomieprojekt bis zum Frühjahr 1985 fort. Wesentliche Schwerpunkte ihrer von einem sozialhistorischen Ansatz motivierten Arbeit waren die Thematisierung faschistischer Kontinuitäten in den Sozialstrukturen der BRD, die revolutionären Entwicklungen im Iran, die Interventionen in die Hausbesetzer- und Anti-AKW-Bewegung, Repression, die Aufarbeitung der Geschichte der italienischen Autonomia, die Klassenanalyse des Imperialismus in den Metropolen sowie der Versuch der Begründung eines »neuen Antiimperialismus«.
Dabei blieb jedoch ihr Verhältnis zur jeweils aktuellen Politik von Autonomen widersprüchlich. In den Heften wechselt ständig der Versuch von einer nüchternen Bereitstellung von »Materialien gegen die Fabrikgesellschaft« im Sinne von Gegeninformationen zu umfassenderen Gesten der politischen Intervention. Diese stellten sich entweder im nachhinein als grandiose Fehleinschätzungen heraus (so z.B. die Schlußfolgerungen aus den Iran-Heften) oder wurden von der autonomen Bewegung nicht aufgegriffen.
»In der Autonomie kommt es 1981/82 zur Krise. Zunehmend stellt sich die Frage nach praktischer Verwendung des angehäuften Wissens über Theorieproduktion und Geschichtsrekonstruktion hinaus. Eine praktische Möglichkeit wird in der Erarbeitung einer sozialrevolutionären Programmatik gesehen, die auf eine Vereinheitlichung der dezentralen Teilbereichskämpfe abzielt. Die Programmatik ... wird unter dem Titel 'Sozialrevolte und Organisationsfrage' Ende 1982 veröffentlicht ... Als wichtigste politische Aufgabe wird die 'Homogenisierung der neuen Massenarmut' bezeichnet, was über den Aufbau dezentraler autonomer Netze erfolgen soll ... Zu dieser Zeit sieht die Autonomie ... in der 'JobberInnenbewegung' das potentielle Subjekt zur 'Homogenisierung der Massenarmut' gegen Sozialabbau und Zwangsarbeit«. Die von dem Autonomie-Kollektiv mit Hilfe von »materialistischer Theorie« in die JobberInnenbewegung hineingepumpten Hoffnungen erfüllten sich jedoch in der Folge nicht. »1985 erscheint die letzte Ausgabe der Autonomie-Neue Folge, die ... nach eigenen Bekunden eine Bilanz der Diskussionen und Ergebnisse vergangener Jahre vorlegt. Inhalt des Heftes sind ... Aufsätze zu verschiedenen Aspekten von proletarischer Sozialgeschichte und der 'technischökonomischen Gewaltmechanismen' von Sozialpolitik gegen die Selbstbestimmung der Klasse. Besonders in diesen Aufsätzen lassen sich die theoretischen Positionen der Redaktion anhand ihrer Auseinandersetzung mit der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie und dem sozialhistorischen Ansatz Thompsons festmachen« (Frombeloff).
Insbesondere die von Detlef Hartmannn in einem Aufsatz über das US-amerikanische Hegemonialsystems von Bretton Woods, begriffen in der Kontinuität der nationalsozialistischen Großraumplanung in den 30er und 40er Jahren, formulierten Thesen zur »Massenarmut« und der »trikontinentalen Subsistenz« spielten in der zwei Jahre später von autonomen Gruppen ausgerufenen Kampagne gegen den IWF-Weltbank-Kongreß in West-Berlin eine durchaus wichtige, wenn auch kontrovers besetzte Rolle.
Das Ende des Autonomie-Zeitschriftenprojekts im Jahre 1985 darf nicht über dessen Bedeutung für die Entwicklung der autonomen Bewegung hinwegtäuschen. In gewisser Weise stellte die »Autonomie Neue Folge« in der personellen Kontinuität einzelner MitarbeiterInnen so etwas wie eine historische Brücke von der Studentenrevolte bis zur autonomen Szene in den 80er Jahren dar. In einer Zeit des theorieabgewandten Pragmatismus stellten sie mit ihren Beiträgen eine Orientierung dar, die Räume weit über die unmittelbare politische Alltagsarbeit der autonomen Gruppen öffnen sollte. Insofern hat das Projekt mit dazu beigetragen, die Autonomen als eine in der Öffentlichkeit politisch verstandene Formation in den 80er Jahren zu entwickeln.
Stadtguerilla und andere bewaffnet kämpfende Gruppen
Zwischen den linksradikalen Gruppierungen im Umfeld der Spontiszene in den 70er Jahren und den Stadtguerillagruppen »RAF«, »Bewegung 2. Juni« und »Revolutionäre Zellen/Rote Zora« existierte immer ein enges, wenn auch nicht widerspruchsfreies Verhältnis.
Die Gruppen entstanden ab Ende der 60er Jahre in den Zentren der Revolte als direkte Antwort auf das Abflauen der Massenkämpfe der APO und deren Begrenzung durch staatliche Repressions- und Integrationsmaßnahmen. Die bewaffneten Gruppen thematisierten mit ihrer politischen Praxis am konsequentesten die »Machtfrage«: Wer die Revolution propagiert, muß sich zugleich auch mit dem Problem der organisierten Massengewalt und des bewaffneten Kampfes auseinandersetzen. Dabei warf diese Form der Politik radikal die Frage nach der persönlichen Integrität und Identität der in diesem Konzept handelnden GenossInnen auf. Der Eintritt in eine bewaffnet kämpfende Gruppe schien zunächst die sonst üblichen klammheimlichen individuellen Hintertürchen des Rückzugs und der Resignation zu verschließen.
Die moralische Dimension die Entscheidung zum bewaffneten Kampf verkleinerte aber auch den Raum dafür, die Grundlagen der verfolgten Linien einer bewaffneten revolutionären Politik stets neu zu bestimmen. Dieser Prozeß wurde zudem durch die staatliche Repression verstärkt. Unabhängig von der tatsächlichen politischen Bedeutung wurde die Linke mit der Existenz der »Stadtguerilla« schon allein dadurch konfrontiert, daß seit Beginn der 70er Jahre ein riesig aufgeblähter Bullenapparat die Jagd gegen sie und die radikale Linke betrieb.
Ganz kurze Geschichte und Konzeptionen der bewaffnet kämpfenden Gruppen in den 70er Jahren
Während sich die RAF anfangs mit ihren Aktionen noch auf die militanten Basisströmungen aus der APO bezog (vgl. z.B. die Erklärung zur Befreiung Andreas Baaders), vollzog sie später einen Richtungswechsel: Aufgrund praktischer Erfahrungen entwickelte die RAF die These von der Unvereinbarkeit von politischer Massenarbeit mit der Tätigkeit einer Guerilla.
Im Kontext der entstehenden K-Gruppierungen vollzog sie einen weiteren politischen Schwenk hin zu an autoritären ML-Mustern angelehnten Kaderprinzipien. Mit diesen Kurswechseln isolierte sie sich zunächst von dem antiautoritären Selbstverständnis der meisten Linksradikalen im Sponti-Umfeld, denen der von der RAF zunehmend proklamierte Führungsanspruch widersprach.
Mit ihren antiimperialistischen Aktionen im Mai 1972 u.a. gegen das Heidelberger Hauptquartier der US-Streitkräfte anläßlich einer erneuten Bombardierung Nordvietnams durch die US-Luftwaffe, ging es der RAF darum, sich auf die existierenden ML-Gruppierungen im Kontext des gemeinsamen APO-Erbes zu beziehen. Aufgrund der unsolidarischen und feigen Verweigerungshaltung eines großen Teils der APO-Linken verschob die RAF schließlich ihre politische Orientierung auf das Terrain des weltweiten antiimperialistischen Befreiungskampfes, in dem sie sich als Arm der im Trikont kämpfenden nationalen Befreiungsbewegungen begriff. Die RAF-Gründergeneration wurde im Sommer 1972 fast vollständig inhaftiert. Die gefangenen GenossInnen verstanden sich im Knast als gemeinsam handelndes politisches Kollektiv und versuchten, sich gegen die mörderischen Haftbedingungen der Isolationsfolter durchzusetzen. Aus dieser Situation entstand auch die »Zusammenlegungsforderung«, die dann zum zentralen Inhalt der Mobilisierungen zu den verschiedenen Hungerstreiks in der Öffentlichkeit wurde.
Die ab 1973 neu entstehenden bewaffnet kämpfenden RAF-Kommandos versuchten in den Jahren 1975-77, durch mehrere Aktionen ihre GenossInnen aus den Knästen freizupressen. Diese »Befreit-die-Guerilla-Guerilla«-Orientierung brach jedoch spätestens nach der gescheiterten »Offensive '77« mit den Aktionen gegen Buback, Ponto und der Schleyer-Entführung in sich zusammen (siehe hierzu auch das Kapitel über den »Deutschen Herbst«).
Im Gegensatz zur RAF verfolgte die Guerillagruppe »Bewegung 2. Juni«, die sich nach ihrem eigenen Selbstverständnis aus dem Jahre 1972 als »Anfang einer Organisation verschiedener autonomer Gruppen der Stadtguerilla« verstand, eine wesentlich stärker an den in den Metropolen herrschenden Widersprüchen orientierte Politik:
»Bewegung 2. Juni ist ein politischer Begriff. Er bezeichnet die alltägliche Konkretisierung des aus der Jugendrevolte der 60er gewachsenen politischen Widerstands. Das heißt, daß die Bewegung 2. Juni von allen jenen verkörpert wird, die versuchten und versuchen, dem alltäglichen kapitalistischen Terror Widerstand und Alternative entgegenzusetzen. Dazu gehören Hausbesetzer und Jugendliche, die ihre Jugendzentren in Selbstverwaltung übernehmen, dazu gehören Knast- und Frauengruppen, Kinderläden und Alternativzeitungen, die Organisatoren von Mietstreiks und Abtreibungsfahrten genauso wie die internationalistischen Solidaritätskomitees mit den Völkern in Vietnam, Iran, Palästina, Angola, West-Sahara oder sonstwo.
Die bewaffneten Kommandos waren Ausdruck und Ergebnis dieser Bewegung, sie kamen aus ihr, wurden von ihr genährt und waren von ihr abhängig auch wenn das heute einige nicht mehr wahrhaben wollen.
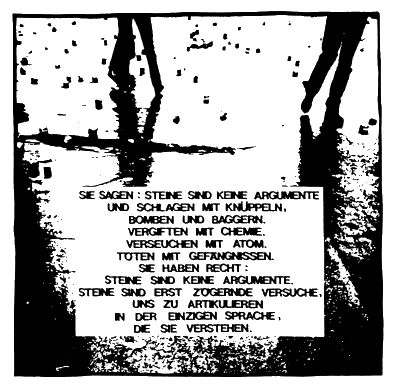 Es war der Versuch, den latenten revolutionären Charakter der Bewegung in exemplarische Aktionen umzusetzen und so die Entwicklung voranzutreiben, die partielle Ohnmacht der Bewegung zum Beispiel gegenüber Knast und Polizei zu überwinden« (aus einem Interview mit Ronald Fritsch, Gerald Klöpper, Ralf Reinders, Fritz Teufel 1978).
Es war der Versuch, den latenten revolutionären Charakter der Bewegung in exemplarische Aktionen umzusetzen und so die Entwicklung voranzutreiben, die partielle Ohnmacht der Bewegung zum Beispiel gegenüber Knast und Polizei zu überwinden« (aus einem Interview mit Ronald Fritsch, Gerald Klöpper, Ralf Reinders, Fritz Teufel 1978).
Nachdem von der ausschließlich in West-Berlin operierenden »Bewegung 2. Juni« eine Reihe von erfolgreichen und populären Aktionen durchgeführt worden waren (so z.B. ein Bankraub, bei dem Schokoküsse an die Kunden verteilt wurden, die Entführung des CDU-Spitzenpolitikers Lorenz »Lorenz-Klau« , mit der Freiheit für ein paar GenossInnen aus dem Gefängnis erzwungen werden konnte), wurde sie in den Jahren 1975/76 durch die Verhaftung von mehreren kämpfenden Gruppen stark geschwächt. In der Folge spalteten sich die zur »Bewegung 2. Juni« zählenden Gefangenen in eine zur RAF tendierende antiimperialistische und eine zum sozialrevolutionären Widerstand zugewandte Richtung.
Ein im Prinzip ähnliches Konzept einer »Basisguerilla« verfolgten auch die »Revolutionären Zellen« und die Frauenguerilla »Rote Zora«. Die »Revolutionären Zellen« schreiben rückblickend auf ihre Gründungsgeschichte und bezugnehmend auf das von ihnen vertretene Konzept ihrer Zeitschrift »Revolutionärer Zorn« vom Januar 1981:
»1973, als eine Revolutionäre Zelle erstmals namentlich Verantwortung für Aktionen übernahm, hatten wir uns am Ausgangspunkt von Massenbewegungen geglaubt, die die verschiedensten Sektoren der Gesellschaft erfassen würden. Anzeichen gab es zur Genüge: Die Streikwelle, die auf Fabriken wie Hoesch, Mannesmann, John Deere, Klöckner usw. überschwappte, signalisierte eine für deutsche Verhältnisse neue Qualität in den Kampfzielen und -formen; an den Fabriktoren der Kölner Fordwerke kristallisierten sich die Umrisse einer sich autonom organisierenden multinationalen Arbeiterklasse heraus. Gleichzeitig gärte es in den Stadtteilen. Die Jugendbewegung hatte mit dem Kampf für selbstverwaltete Jugendzentren wieder ein verbindendes politisches Motiv gefunden, das bis in die kleinsten Provinzstädte widerhallte. In den Hausbesetzungen kam der radikale Wille zum Durchbruch, sich tatsächlich das zu nehmen, was wir brauchten. Mit dem Schwarzfahren, dem Ladenklau, dem Krankfeiern wurden andere Formen des Widerstandes als eminent politisch entdeckt, die bis dahin lediglich privaten Charakter hatten. Zur gleichen Zeit entwickelte sich in rasantem Tempo mit der Frauenbewegung eine neue gesellschaftliche Kraft, die vor 1975 in der Kampagne gegen den § 218 ihren Höhepunkt als überregionale Bewegung erlebte ... Vor diesem Hintergrund entstand ein Konzept des bewaffneten Kampfes, in dem die Stärkung der Masseninitiativen durch klandestin operierende autonom und dezentral organisierte Gruppen der erste Schritt eines langwierigen Angriffs auf die Macht sein sollte. Was wir wollen, ist die Gegenmacht in kleinen Kernen organisieren, die autonom in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten, kämpfen, intervenieren, schützen, die Teil von der politischen Massenarbeit sind. Wenn wir ganz viele Kerne sind, ist die Stoßrichtung für die Stadtguerilla als Massenperspektive geschaffen« (Revolutionärer Zorn Nr. 1, Mai 1975).
Bemerkenswert an der öffentlichen Wahrnehmung der »Revolutionären Zellen«, die erst nach den Erfahrungen mit der RAF gegründet wurden, erscheint der Umstand, daß ihre Existenz im öffentlichen Bewußtsein bei weitem nie den gleichen Stellenwert einnahm wie die in den Jahren 1970-72 bis auf den heutigen Tag negativ institutionalisierte RAF.
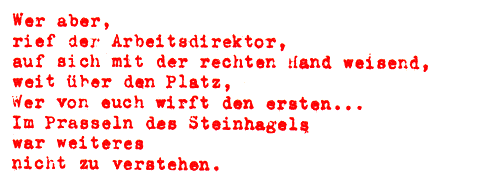 Deutscher Herbst 1977
Deutscher Herbst 1977
Das Jahr 1977 ist einerseits durch das massive Auftreten einer militanten Anti-AKW-Bewegung geprägt, die im Frühjahr bei dem Versuch der Bauplatzbesetzung in Grohnde einen bisher in der BRD nicht wieder erreichten Grad an organisierter Massenmilitanz erreichte. Auf der anderen Seite betraten zwei Jahre nach der Botschaftsbesetzung 1975 in Stockholm wieder Kommandos der RAF die Bühne. Im Frühjahr wurde Generalbundesanwalt Buback und im Sommer der Chef der Dresdner Bank, Ponto, hingerichtet.
Mit der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer, des »Bosses der Bosse«, durch die RAF in Köln begann ab dem 5. September der sogenannnte »Deutsche Herbst«. Ziel dieser Aktion war es, eine große Anzahl von RAF-Gefangenen aus dem Gefängnis zu befreien. Die Bundesregierung verhängte sofort eine Informationssperre gegenüber der Presse. In der Folge kamen die Medien dieser Strategie der von oben erwünschten Gleichschaltung bereitwillig nach.
Zugleich wurden von den staatlichen Instanzen für 44 Tage, vermittels der Gewalt eines in der Verfassung nicht vorgesehenen, d.h. illegalen »Großen Krisenstabes« die Mechanismen der bürgerlichen Demokratie außer Kraft gesetzt. Unter Bruch aller Fristen parlamentarischer Beratungsregularien wird das sogenannte »Kontaktsperregesetz« in Rekordzeit im Bundestag eingebracht und beschlossen. Es sieht eine vollständige Isolierung der RAF-Gefangenen von der Außenwelt vor. Die davon betroffenen Gefangenen dürfen keine Zeitung, kein Fernsehen, kein Radio und vor allem keine Besuche mehr von Angehörigen, Anwälten oder sonstigen Personen erhalten. Es stellt quasi eine Art staatlicher Geiselnahme von Gefängnisinsassen dar. Noch bevor das Gesetz rechtskräftig geworden war, wurden Anwälte von den Gefängnisbehörden am Besuch ihrer Mandanten gehindert. Die offensichtliche Illegalität der staatlichen Maßnahme wird zwar von dem zuständigen Richter bestätigt, dessen daraufhin getroffene Anordnung, dem Rechtsanwalt Zugang zu seinem Mandanten zu verschaffen, wurde aber von den staatlichen Instanzen ignoriert.
Am 24. September organisierte die internationale Anti-AKW-Bewegung eine Massendemonstration gegen den Bau des Schnellen Brüters in Kalkar. Diese endete jedoch weitgehend im Vorfeld in einem bis dato nicht gekannten Ausmaß der staatlichen Repression. Die Bullen sperrten eine Reihe von Autobahnen vollständig ab, so daß in der ganzen BRD auf der Nord-Süd-Autobahnachse der Verkehr zum Erliegen kam. Dabei wurden mindestens 125.000 (!) Personalienüberprüfungen vorgenommen, Polizeihubschrauber hielten auf offener Strecke Bundesbahnzüge an, die ebenso wie ganze Buskonvois von mit Maschinengewehren bewaffneten Bullen durchsucht wurden. Die meisten DemoteilnehmerInnen kamen entweder gar nicht oder viel zu spät zu der geplanten Kundgebung. Die im Verlauf der Anreise zu dieser Demo gemachten Erfahrungen führten innerhalb der Bewegung zum sogenannten »Kalkar-Schock« und in der Folge zu einer teilweisen Demoralisierung der Anti-AKW-Strukturen.
Nachdem von dem »Großen Krisenstab« gegenüber den Entführern Schleyers eine Hinhaltetaktik eingeschlagen worden war, spitzte sich die Situation nach der Flugzeugentführung einer Lufthansamaschine aus Mallorca am 13. Oktober zu: Die Geiselnahme von zufällig in diesem Flugzeug sitzenden Touristen sollte, aus Sicht eines arabischen Kommandos, den Druck auf die Bundesregierung zur Freilassung der RAF-Häftlinge erhöhen. Im »Großen Krisenstab« wurden die Bemühungen verstärkt, um zu einer militärischen Lösung des ganzen Problems zu kommen. In diesem Zusammenhang wurden zunehmend »exotische Gedankenspiele« erörtert, in denen z.B. Strauß und der Generalbundesanwalt Rebmann offen für die Hinrichtung der RAF-Gefangenen plädierten. Nachdem diese »Gedankenspiele« auch öffentlich über Fernsehen, u.a. von Golo Mann, propagiert wurden, kam es schließlich am 17.10. zu einer Beendigung der Flugzeugentführung durch ein GSG 9-Kommando, welches das Flugzeug in Mogadishu stürmte und die Entführer tötete. Am nächsten Morgen wurden die sich in totaler staatlicher Verfügungsgewalt befindlichen RAF-Gefangenen Andreas Baader, Jan Carl Raspe und Gudrun Enslin tot und Irmgard Möller lebensgefährlich verletzt in ihren Zellen aufgefunden. Schon einige Stunden danach verbreiteten staatliche Stellen die Version vom Selbstmord der Gefangenen, wobei die genauen Umstände ihres Todes damals wie heute ungeklärt sind. Am Abend des 18. Oktober wurde schließlich Schleyer tot in einem Auto in Straßburg aufgefunden.
Der Verlauf und die Ereignisse des »Deutschen Herbstes« wurden für die neue Linke zu einer Zäsur und einem Fixpunkt ihrer eigenen Identität. Während ein Teil sich in unterwürfiger Distanzierung dem Staat als Grenzträger der Macht anzudienen suchte (vgl. hierzu die Erklärung der 177 Hochschullehrer), verharrte der größere Teil aufgrund der Ereignisse im sprachlosen Schweigen. Gerade in Folge der RAF-Aktionen war die linksradikale Spontiszene mit einem enormen Ausmaß an staatlicher Repression konfrontiert. Der bereits nach dem »Mescalero«-Nachruf zur Buback-Erschießung im Frühjahr lastende Repressionsdruck verschärfte sich nochmals im Herbst: Ganze Straßenzüge wurden von mit Maschinengewehren ausgerüsteten Bullen abgeriegelt, gegen bekannte Linksradikale wurden mehr als einmal von den Bullen mit gezogener Knarre Personalienüberprüfungen durchgeführt, Treffpunkte der Szene wurden durchwühlt.
Der »Deutsche Herbst« traf die undogmatischen Linksradikalen in einer Phase der Umorientierung, weg von den verlorengegangenen Betriebsinterventionen und Häuserkämpfen hin zu den bis dato erfolgreichen Anti-AKW-Aktionen. Dieser politischen Wende wurde aber durch die Ereignisse nach dem »Kalkar-Schock« die Spitze gebrochen. In dem antiimperialistischen Szenario von Attentaten und Flugzeugentführungen der 77er RAF-Offensive spitzten sich die bereits 1972 in den Richtungswechseln der RAF angelegten Spaltungs- und Trennungsprozesse zu den Linksradikalen zu. Die während der Schleyer-Entführung unter dem Druck der staatlichen Repression noch verschärfte sprachlose Statisten- und Zuschauerrolle der Spontis wurde durch die massive Distanzierung und Entsolidarisierung des linksliberalen und akademischen 68er Milieus vollends zu einem traumatischen Erlebnis für die Linksradikalen.
Eine Reise nach TUNIX
Ende Januar 1978 kam es in West-Berlin zum TUNIX-Treffen. Etwas über drei Monate nach dem »Deutschen Herbst« war es von GenossInnen aus dem Sponti-Umfeld mit einer politischen Stoßrichtung gegen das »Modell Deutschland« vorbereitet worden. Das »Modell Deutschland« war spätestens nach den Ereignissen im Herbst '77 zum Synonym für eine scharfe Repressionspraxis gegen die Linke geworden. In diesem Zusammenhang wurde sowohl die Frage eines »neues Faschismus« diskutiert als auch erste Vorbereitungen für die Durchführung eines »Russell-Tribunals« über die Situation der Menschenrechte in der BRD getroffen. Die Sponti-Linke veröffentlichte in dieser Situation einen Aufruf, in dem offensiv der Auszug aus dem »Modell Deutschland« propagiert wurde:
»Uns langt's jetzt hier! Der Winter ist uns zu trist, der Frühling zu verseucht und im Sommer ersticken wir hier. Uns stinkt schon lange der Mief aus den Amtsstuben, den Reaktoren und Fabriken, von den Stadtautobahnen. Die Maulkörbe schmecken uns nicht mehr und auch nicht mehr die plastikverschnürte Wurst. Das Bier ist uns zu schal und auch die spießige Moral. Wir woll'n nicht mehr immer dieselbe Arbeit tun, immer die gleichen Gesichter zieh'n. Sie haben uns genug kommandiert, die Gedanken kontrolliert, die Ideen, die Wohnung, die Pässe, die Fresse poliert. Wir lassen uns nicht mehr einmachen und kleinmachen und gleichmachen. Wir hauen alle ab! ... zum Strand von Tunix.«
Die Vorbereitung und der Ablauf des Treffens war Ausdruck mehrerer Entwicklungslinien der radikalen Sponti-Linken in der BRD, die sich grob mit den Stichworten »Mescalero-Stadtindianer«, »Krise der Linken« und »Zwei Kulturen« fassen lassen.
Die Sponti-Linke hatte spätestens ab Mitte der 70er Jahre, nachdem die Mobilisierungswirkung der studentischen K-Gruppen nachgelassen hatte, mit sogenannten »Basisgruppen« an großer Attraktivität gewonnen und in einer Reihe von Unis die Studentenvertretungen gestellt. In diesem Umfeld entwickelte sich, auch beeinflußt durch die Ereignisse in Italien, eine Art Stadtindianer-Bewegung, deren markantester Ausdruck der vom Genossen »Mescalero« aus Göttingen verfaßte »Buback-Nachruf« im Frühjahr 1977 wurde. Die dort zunächst ausgedrückte »klammheimliche Freude« über die Hinrichtung Bubacks wird am Schluß mit der Feststellung relativiert:
»Unser Zweck, eine Gesellschaft ohne Terror und Gewalt (wenn auch nicht ohne Aggression und Militanz), eine Gesellschaft ohne Zwangsarbeit (wenn auch nicht ohne Plackerei), eine Gesellschaft ohne Justiz und Anstalten (wenn auch nicht ohne Regeln und Vorschriften oder besser: Empfehlungen), dieser Zweck heiligt eben nicht jedes Mittel, sondern nur manches. Unser Weg zum Sozialismus (wegen mir: Anarchie) kann nicht mit Leichen gepflastert sein.«
Obwohl das Pamphlet eine deutliche Kritik an der RAF beinhaltete, löste es eine massive staatliche Kriminalisierungswelle gegen die undogmatische Linke in der ganzen BRD aus. Teile der linksradikalen politischen Szene in Göttingen wurden mit Hausdurchsuchungen überzogen, im Bundesgebiet kam es zu über 100 Ermittlungsverfahren gegen Herausgeber und Zeitungen, die den Aufruf aus Solidarität gegen die Repression aus der Göttinger AStA-Zeitung nachgedruckt hatten. Nachdem eine Reihe von Professoren den »Buback-Nachruf« unter ihrem Namen neu herausgegeben hatten, wurden sie sofort disziplinarrechtlich belangt. In Niedersachsen wurde von den Herausgebern eine »Treue-Erklärung zum Staat« abverlangt, die Peter Brückner verweigerte, weswegen er u.a. von seinem Uni-Job suspendiert wurde.
Die Repressionen der staatlichen Instanzen dienten dazu, die politischen Widersprüche innerhalb der Linksradikalen einzuebnen, um sie an der »Gewaltfrage« zu polarisieren.
In der Reaktion auf diese Repression entstand in einem Zusammenhang von Resignation, anarchistischer Revolte und Fluchtwünschen die Idee des TUNIX-Treffens, das der Sponti-Linken nach dem »deutschen Herbst« zu neuem Selbstbewußtsein verhalf. Das Autorenkollektiv aus der Vorbereitungsgruppe Quinn der Eskimo, Frankie Lee und Judas Priest schreibt dazu:
»Die Schwäche der Linken war und ist in ihrer Unfähigkeit begründet, die Tendenzen zur Herrschaftssicherung begreifbar, faßbar zu machen, deren subtilen Charakter eine subversive Strategie entgegenzusetzen. Unzufriedenheit war ein wesentliches Moment für den 'Massenerfolg' von TUNIX. Aber nicht etwa nur eine Unzufriedenheit mit den Zuständen und Perspektiven in der BRD, die zumindestens unter der Oberfläche millionenfach gärt, sondern Unzufriedenheit mit dem, was an Veränderungsstrategien angeboten wird. Darin war das Bedürfnis, mit gleichermaßen Unzufriedenen zusammenzukommen, begründet.
Für uns spielte auch die Unzufriedenheit mit unserem eigenen Verhalten eine große Rolle. Miteinzustimmen in den Chor der Distanzierer oder Rücksicht zu nehmen auf das allgemeine Klima erschien uns als Verleugnung unserer Identität. So war es wohl auch eine Trotzreaktion im Stil von Jetzt-erst-recht-linksradikal, als wir zur Reise nach TUNIX aufriefen. Unsere Identität ist ausschließlich eine 'linksradikale'. Wenn wir uns darin verleugnen, bleibt von uns nur noch Zynisches übrig ... Wegen der Befürchtung, unsere Identität würde angeknackst werden, wenn wir uns der Situation Herbst '77 entziehen würden, wurden wir initiativ und haben dabei zum Prinzip gemacht, öffentlich und angreifbar zu dem zu stehen, was wir wollen. Weder von Verfassungsspitzeln noch von politischen??? wollten wir uns einschüchtern lassen.«
Diese Stimmung drückte sich auch in der zum Abschluß des Treffens durchgeführten Demonstration aus. Zur Illustration ein Auszug aus einem Bericht des »Tagesspiegel« vom 29.1.1978:
»Zum erstenmal seit langem kam es gestern in Berlin wieder zu einer gewaltsamen Demonstration. Aus dem Zug von etwa 5.000 Teilnehmern an dem dreitägigen 'TUNIX'-Treffen in der Technischen Universität, die aus Berlin, Westdeutschland und dem westeuropäischen Ausland gekommen waren darunter sogenannte Spontis und Stadtindianer sowie andere nicht-organisierte Linke , wurde vor dem Frauengefängnis in der Lehrter Straße zunächst mit Farbeiern gegen Polizeibeamte und später dann vor dem Gerichtsgebäude in der Moabiter Turmstraße bereits mit Pflastersteinen geworfen ... Einzelne Einsatzwagen der Polizei wurden von den Demonstranten mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert ... Zu einem regelrechten Steinhagel kam es dann vor dem Amerikahaus in der Hardenbergstraße. Die Polizeibeamten hatten den Demonstrationszug durch Schlagstockeinsatz zeitweise geteilt, nachdem die ersten Steine gegen das Amerikahaus geflogen waren und in dem Zug aufgerufen worden war, zur Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße zu laufen. Daraufhin warfen Teilnehmer aus dem abgetrennten Zug einen wahren Steinhagel, so daß die Polizei zurückweichen mußte und sich der Zug wieder vereinen konnte. Er zog zum Kurfürstendamm ...
Eine große deutsche Fahne war mit der Aufschrift 'Modell Deutschland' an einen Lautsprecherwagen der Demonstranten gebunden und durch den Straßenschmutz gezogen worden. An der Ecke Kurfürstendamm/Joachimstaler Straße wurde die Fahne dann vor den Augen von Polizisten und Passanten in Brand gesteckt ... In dem Zug waren von Anarchisten Transparente mit Aufschriften 'Stammheim ist überall' mitgetragen worden und 'Weg mit dem Dreck' sowie 'Pfui Deibel'. Zahlreiche Häuserwände entlang des Demonstrationszuges wurden mit Farbaufschriften beschmiert, wie 'Laßt die Agit-Drucker frei' oder 'Anarchie ist möglich'. Vor den Gefängnissen forderten die Demonstranten in Sprechchören: 'Laßt die Gefangenen frei'.«
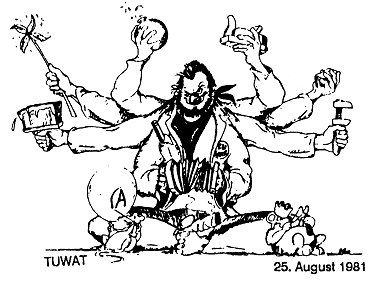 Der Ablauf von TUNIX machte ein Netz von Kommunikations- und Informationszusammenhängen sichtbar, das innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Aufrufes in der Lage war, 15-20.000 Menschen zu einer Teilnahme zu bewegen. TUNIX war der Höhepunkt, das letzte »Feuerwerk« der bundesdeutschen Sponti-Bewegung aus den 70er Jahren. Einerseits gelang es den Spontis, sich vorübergehend als Kommunikationszusammenhang nach dem »Deutschen Herbst« zu reorganisieren, andererseits führte die auf dem Treffen propagierte Aussteigerwelle aus dem SPD-»Modell Deutschland« zu einer nachfolgenden Zersetzung und dem Zerfall der Bewegung in eine Gesellschaft der »Zwei Kulturen«.
Der Ablauf von TUNIX machte ein Netz von Kommunikations- und Informationszusammenhängen sichtbar, das innerhalb eines Monats nach Veröffentlichung des Aufrufes in der Lage war, 15-20.000 Menschen zu einer Teilnahme zu bewegen. TUNIX war der Höhepunkt, das letzte »Feuerwerk« der bundesdeutschen Sponti-Bewegung aus den 70er Jahren. Einerseits gelang es den Spontis, sich vorübergehend als Kommunikationszusammenhang nach dem »Deutschen Herbst« zu reorganisieren, andererseits führte die auf dem Treffen propagierte Aussteigerwelle aus dem SPD-»Modell Deutschland« zu einer nachfolgenden Zersetzung und dem Zerfall der Bewegung in eine Gesellschaft der »Zwei Kulturen«.
Der Begriff »Zwei Kulturen« kam aus den italienischen Diskussionen und entstand im Zusammenhang mit den Konflikten der Autonomiabewegung '77 gegenüber der PCI. In der BRD wurde er vom damaligen Berliner SPD-Wissenschaftssenator Glotz propagandistisch mit dem Ziel aufgenommen, neue Dialog- und Integrationsstrategien gegen die Linksradikalen zu praktizieren. Die perfide Logik in der Anwendung des Begriffs durch den Sozialtechnokraten Glotz lag darin, die widerständigen und autonomistischen Impulse der entstehenden Alternativbewegung im »politischen Diskurs« zu entpolitisieren. Die »Alternativkultur« sollte für die »Mehrheitskultur« als eine Art gesellschaftliches »Soziallaboratorium« und »Experimentierfeld« dienen. Unter sozialdemokratischer Hegemonie sollten dann die innovativsten und wettbewerbsträchtigsten Impulse aus der »Alternativkultur« für eine modernisierte bürgerliche Gesellschaft vereinnahmt werden. Allerdings wurde die Vorstellung von zwei sich ergänzenden Kulturen auch von einem Teil der Spontiszene begeistert aufgenommen, da er quasi von höchster Stelle das eigene Selbstverständnis der Form nach anerkannte. Darüber wurde zudem die scheinbar praktikable Illusion verstärkt, sich den kapitalistischen Herrschafts- und Ausbeutungsmechanismen der »Mehrheitskultur« durch den Aufbau einer »Gegen- oder Alternativkultur« entziehen zu können.
In den Jahren 1978-80 kommt es zu der bis dato stärksten Gründungswelle von ökonomischen Alternativprojekten. Damit setzte sich die bereits in Frankfurt nach dem Abflauen der Häuserkämpfe abzeichnende Tendenz bundesweit verstärkt fort. West-Berlin wurde dabei zur »heimlichen Hauptstadt« der Alternativbewegung. Schätzungen aus dem Jahr 1979 gehen davon aus, daß sich in der Stadt rund 100.000 Menschen in einem sehr weiten Sinne der Alternativszene zugehörig fühlten. Die von Linksradikalen diskutierte Befürchtung einer reibungslosen, selbstzufriedenen und genügsamen Integration dieser Bewegung in die herrschenden Verhältnisse bestätigte sich zunächst jedoch nicht. Gerade in West-Berlin wurde die Alternativbewegung zum Mobilisierungsboden für die in den Jahren 1979/80 entstehenden Ansätze einer Instandbesetzerbewegung. Um die Jahreswende '80/'81 kam es dort zu einer nicht erwarteten Hausbesetzerbewegung, in deren Zusammenhang ein sogenannter TUWAT-Kongreß organisiert wurde. Hier wurde dann ganz selbstverständlich über die Bedeutung der Theorien aus der italienischen Autonomia für den Häuserkampf diskutiert. Nicht nur an diesem Beispiel werden Kontinuitäten sichtbar.